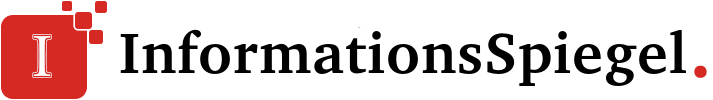taz: Frau Ewe, welche Kulturpolitik verfolgte Hamburg im Dritten Reich?
Gisela Ewe: Wie im ganzen Land war die kulturpolitische Ausrichtung innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung anfangs umstritten. Man war sich nicht einig, welche Kunstrichtungen akzeptiert, welche ausgeschlossen werden sollten. Ob man an einen bürgerlichen Kanon anknüpfen oder den Kulturbetrieb für andere Schichten öffnen sollte.
taz: Wie äußerte sich das?
Ewe: 1936 fand in den Räumen des Hamburger Kunstvereins eine Ausstellung des Künstlerbundes statt: „Malerei und Plastik in Deutschland“. Dort hingen auch Werke der klassischen Moderne, von Hamburgs Kulturpolitikern genehmigt. Aber nach zehn Tagen wurde die Schau vom Leiter der Reichskunstkammer Berlin eigenhändig geschlossen. Danach durfte in Deutschland keine klassische Moderne mehr gezeigt werden.
=”” div=””>
taz: Welche Rolle spielte die Kulturbehörde im NS-Regime?
Ewe: Sie wurde erst 1933 gegründet, musste also nicht gleichgeschaltet werden. Kulturpolitik war bis dato Privatangelegenheit, Sache der Mäzene – wobei sich die Zuständigkeit im 19. Jahrhundert langsam zum Staat verschob. In Hamburg gab es vor 1933 mehrere Kommissionen, die über die Verteilung staatlicher Zuschüsse entschieden.
taz: Wer leitete die neue Behörde?
Ewe: Überzeugte Nazis, die zum engen Kreis um Gauleiter Karl Kaufmann gehörten. Das war von 1933 bis 1938 Wilhelm von Allwörden, seit 1925 Mitglied der NSDAP. Von 1938 bis 1945 leitete Helmut Becker die Behörde, seit 1932 Parteimitglied. 1940 wurde er auch Kultursenator.
taz: Wie viel Macht hatten diese Leute?
Ewe: Sie besetzten vor allem die Leitungsposten etwa an Theatern und Museen. Später wurden nach und nach jüdische Mitarbeiter herausgedrängt. In den ersten Jahren war der Leiter der Kulturbehörde in Personalunion auch Leiter der Kunsthalle, des Museums für Kunst und Gewerbe sowie der Landeskunstschule. Eine enorme Machtfülle.
taz: Wie veränderten sich die Theaterspielpläne?
Ewe: Zeitkritische Stücke und solche jüdischer Autoren durften aus politischen beziehungsweise antisemitischen Gründen nicht mehr gespielt werden. Das Programm verschob sich zu Klassikern und Unterhaltung. Man wollte mit solchen für große Teile der Bevölkerung attraktiven Stücken Sympathie fürs Regime erzeugen und Kontinuität bieten, die die sonstigen Veränderungen abfederte.
=”” span=””>
=”” div=””>
taz: Und man förderte NS-nahe Künstler.
Ewe: Ja. Aber die Nazis hatten das Problem, dass durch all das, was sie ausschlossen, sehr viel qualitätvolle Kunst wegfiel. Diese Leerstelle konnten sie aus den eigenen Reihen nicht füllen. Denn viele, die nun ihre Chance witterten, waren vielleicht überzeugte Nazis, aber nicht unbedingt begabte Künstler.
taz: Wie sahen NS-konforme Ausstellungen aus?
Ewe: Die Kunsthalle zeigte 1937 die Ausstellung „Volk und Familie“, konzipiert gemeinsam mit der SS. Darin wurden Gemälde aus verschiedenen Epochen, die – aus Sicht des NS-Regimes – idealtypische deutsche Familien zeigten, neben zeitgenössische Fotos deutscher Bauernfamilien gehängt. Hier verband sich das NS-Kunstverständnis direkt mit der Rassenideologie.
taz: Wie gut ist die Rolle von Kulturbehörden aufgearbeitet?
Ewe: Kaum. Unser Projekt leistet quasi Pionierarbeit. Eine wichtige Quelle sind dabei die Unterlagen von Albert Krebs. Obwohl er als ehemaliger Abteilungsleiter der Kulturbehörde überzeugter Nazi war, wurde er nach 1945 mit der Erforschung der Kulturbehörde in der NS-Zeit beauftragt. Sein Manuskript ist für uns wichtig, um Details zu rekonstruieren. Aber ist es auch eine schwierige Quelle, weil Krebs darin seine eigene Reinwaschung betrieb.