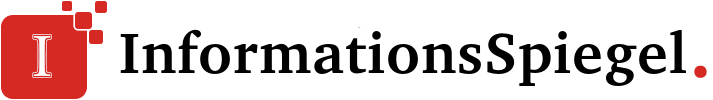„Möchte ich auswandern, denke ich mir, oder muss ich das irgendwann?“, sagt Ayşe Irem ins Mikrofon bei der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Chemnitz am Wochenende. Ein Satz, der bleibt. Er schneidet durch die Oberfläche dieses Abends, getragen von einer Stimme, die ruhig klingt und doch von vielem erzählt. Auf der Bühne steht eine 26-Jährige aus Bielefeld, helles Kopftuch, runde Brille, das Smartphone als Manuskript in der Hand. Ihre Sprache ist präzise gesetzt. Sie kennt das Entstehen von Räumen, sie hat Architektur studiert. Doch die Räume, die ihr Leben bestimmen, sind andere – gebaut aus Herkunft, Haut, Sprache.
Irem beginnt ihren Beitrag in Chemnitz mit einem fiktiven Dialog. „Kannst du dir vorstellen, auszuwandern?“ Eine Frage, so leicht gesagt, dass man fast übersieht, wie viel sie trägt. Doch sie antwortet nicht mit Sehnsucht, sondern mit Bildern, die viele kennen und doch kaum jemand ausspricht: den Pausenhof, auf dem Türkisch verboten war; die Namen, die nicht dazugehören; die Städte, deren Namen zu Wunden geworden sind – Solingen, Hanau, Halle.
„Weil wir einfach nicht weiß genug waren“, sagt sie. Diese Zeilen treffen ins Herz dessen, was man Alltagsrassismus nennt – ein Begriff, der oft zu abstrakt klingt für das, was er meint. Bei ihr wird er konkret, greifbar, poetisch und schmerzhaft zugleich. Sie beschreibt nicht die großen, eruptiven Ereignisse, sondern die leisen Verletzungen, die sich summieren: die Frage nach der Herkunft, das Fremdeln im eigenen Land, die Erfahrung, immer etwas erklären zu müssen.
Ausgerechnet in Chemnitz
Dass Ayşe Irem ausgerechnet in Chemnitz auftritt, verleiht diesem Abend ein eigenes Gewicht. Eine Stadt, die einst zum Symbol rechter Aufmärsche wurde, wird zum Schauplatz eines anderen, leiseren Triumphes. Auf dieser Bühne steht eine junge Muslima und spricht über Rassismus, Zugehörigkeit, Sichtbarkeit. Es ist mehr als ein Sieg. Es ist ein Zeichen, dass sich etwas verschiebt, wer hier spricht – und wem zugehört wird. Ayşe Irem ist die erste Muslimin, die diesen Titel gewinnt, die erste Migrantin, erst die dritte Frau überhaupt. Zahlen, die erzählen, wie lange es gedauert hat, bis solche Stimmen gehört werden – und dass sie nun bleiben, hoffentlich.
Es geht nicht um Integration, sondern um das Recht, einfach da zu sein
Irem tritt für „i,Slam“ an – ein Netzwerk muslimischer Poetry-Slammer*innen, das seit Jahren Stimmen auf die Bühne bringt, die sonst am Rand bleiben. Diese Zugehörigkeit ist für sie kein Label, sondern Haltung: Teilhabe als Selbstverständnis, Sichtbarkeit gegen das Verschwinden. Es geht nicht um Integration, sondern um das Recht, einfach da zu sein.
Vielleicht hat da auch das Architekturstudium ihr Schreiben beeinflusst: das Bedürfnis, Räume zu öffnen, in denen Menschen wie sie nicht erklären, sondern erzählen dürfen. Wo Sprache als Zuhause funktioniert. Wo ein Satz wie „nie weiß genug zu sein“ nicht nur ein Gefühl beschreibt, sondern ein System entlarvt. Ihre Worte sind keine Anklage, sie sind Spiegel. Wer zuhört, erkennt darin ein Land, das sich postmigrantisch nennt und doch weiter sortiert, fragt, bewertet. Und zugleich spiegeln sie eine Generation, die den Ton wechselt – leise, klug, entschlossen.
Am Ende ihres Auftritts in Chemnitz fragt wieder die Stimme aus dem Off: „Hast du nie darüber nachgedacht, auszuwandern?“ Und Irem antwortet ruhig, beinahe sachlich: „Doch, habe ich.“ Einen Atemzug später fügt sie hinzu: „Du lächelst. Du glaubst, wir würden beide ans Auswandern denken. Du glaubst auch, es wäre aus denselben Gründen.“