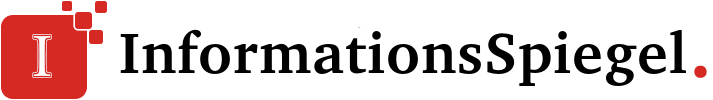Als am 5. Dezember um 10 Uhr morgens die Stunde schlug, waren die Berliner:innen vorbereitet. Über 50 von ihnen fanden sich innerhalb kürzester Zeit in einem speziell errichteten Kinosaal im Erdgeschoss der Neuen Nationalgalerie ein. Die Gäste ließen sich auf den 24 reihenweise angeordneten Ikea-Sofas im Saal nieder. Bis zum Tag darauf sollte kaum einer dieser Plätze lange leer bleiben.
Sie alle kamen, um ein Stück Kunstgeschichte zu erleben. Denn nichts weniger als das ist Christian Marclays Videokunstwerk The Clock, für das die Neue Nationalgalerie zweimal für 34 Stunden ununterbrochen ihre Pforten öffnet. Grund genug, daraus einen Selbstversuch zu machen.
Bei „The Clock“ handelt es sich um einen sogenannten Supercut, also eine enorme Aneinanderreihung verschiedenster Filmsequenzen, die alle etwas gemeinsam haben. In diesem Fall spielt beinahe jede Szene zu einer genauen Tageszeit, die entweder auf einer Uhr zu sehen ist oder von einer Figur angesagt wird.
Wenn also Kyle MacLachlan in „Twin Peaks: Fire Walk with Me“ über den Bildschirm stürmt und David Lynch anschreit, dass es 10.10 Uhr sei, dann stimmt das auch in der Außenwelt. So entsteht ein 24-Stunden-Zyklus ohne Anfang und Ende, der in Echtzeit mitläuft.
Man weiß immer, wie spät es ist
Das bietet viele Vorteile: Man braucht weder Handy noch Armbanduhr – und weiß immer, wie lange man schon vor der Leinwand verbracht hat. Für mich waren es zweieinhalb Stunden, bis ich die erste Pause einlegte. Die Zeit bis dahin verging überraschend schnell, denn es finden sich immer wieder Höhepunkte im Programm.
=”” span=””>
Christian Marclay: „The Clock“. Neue Nationalgalerie, bis 25. Januar. Eine weitere 34-Stunden-Montage läuft am 2. Januar 2026 ab 10 Uhr bis zum Folgetag um 20 Uhr
=”” div=””>
Um 10.37 Uhr etwa läuft Jean-Pierre Léaud als kleiner Junge in François Truffauts legendärer Schlussszene aus „Sie küssten und sie schlugen ihn“ über den Strand der Normandie. Um Punkt 11 Uhr fällt Harry und Ron auf, dass sie den Hogwarts-Express vom Gleis 9¾ verpasst haben.
Ab 11.42 Uhr hängt sich Robert Powell in „Die 39 Stufen“ vom Minutenzeiger des Big Ben, um eine Bombenexplosion zu verhindern. Der ikonische Uhrturm taucht im Laufe des Tages immer wieder auf. Und um 12 Uhr läutet Charles Laughton als „Glöckner von Notre-Dame“ theatralisch die Tagesmitte ein.
Bis hierhin gleicht der Vorführraum beinahe einem gemütlichen Wartezimmer für Cineasten: Circa alle zehn Minuten erhebt sich jemand vom Sofa und jemand anderes rückt nach. Gedränge gibt es keins und nur wenige Gäste sitzen verteilt auf dem ausgerollten schwarzen Teppich. Doch das ändert sich am Abend abrupt.
Ohne Schlange kein Berlin
Es ist beinahe, als wäre es ein Naturgesetz der Stadt: wo Spektakel, da Schlange. Die formierte sich gegen 20 Uhr prompt, als der außergewöhnliche Teil der Vorstellung begann: die verlängerte Öffnung der Nationalgalerie, um auch die Nacht- und Morgenstunden von „The Clock“ zeigen zu können – und somit das Werk in Gänze.
Der Saal ist jetzt brechend voll, überall sitzen, liegen und lehnen Menschen. Nach 23 Uhr verlässt kaum noch jemand den Raum. Zu gespannt ist man auf das, was kommt. Auch wenn den Ersten bereits die Augen zufallen. Doch selbst das offenbart neue Eindrücke. Denn Marclay, der mit „The Clock“ 2011 die Venediger Biennale gewann, ist ein mindestens genauso renommierter Audio- wie Videokünstler.
Um 1.48 Uhr ertönten vom Bildschirm die hypnotischen Worte You’re feeling sleepy. Youre going to bed. Close your eyes. Neben mir schnarchte es bereits lautstark
Die Tonspuren der schier endlosen Uhr-Szenen – im Schnitt sind es etwa acht pro Minute – gehen meist nahtlos ineinander über. Oft plätschern die Geräusche eines Ausschnitts noch in den nächsten, bevor sie langsam von neuen Soundkulissen abgelöst werden. Und dann folgt plötzlich wieder ein abrupter Cut: wenn ein Telefon klingelt, eine Pistole feuert, Lola rennt. Letzteres wird kurz vor Mittag von wabernden Elektrobeats umrahmt, die genauso schnell wieder abebben, wie sie aufkamen. Lola wird erst morgen wieder rennen.
Zur Geisterstunde schlägt es zum zweiten Mal zwölf, und zwar auf mindestens einem Dutzend Uhren. Der verdammte Big Ben, der zigmal über die Leinwand flimmerte, explodiert in „V wie Vendetta“. Auch dieses Spektakel dauert nur wenige Sekunden, doch der laute Knall des berstenden Uhrglases wirkt fast schon erlösend.
Zurück zum Anfang
Nach Mitternacht kapitulierten nicht nur das Londoner Wahrzeichen, sondern auch die Berliner:innen nach und nach. Die Schlange wurde immer kürzer, bis sie gegen ein Uhr völlig verschwand. Kurz vor zwei Uhr waren noch etwa 100 Menschen im Saal.
Um 1.48 Uhr ertönten vom Bildschirm die hypnotischen Worte „You’re feeling sleepy. You’re going to bed. Close your eyes.“ Neben mir schnarchte es bereits lautstark. Zu müde, um wach zu bleiben, und zu unbequem, um wirklich zu ruhen, entschied ich nach fast 16 Stunden, den Rückzug anzutreten. „The Clock“ hatte gewonnen.
Ganz aufgeben konnte ich freilich nicht. Der 24-Stunden-Zyklus musste geschlossen werden. Deshalb fand ich mich samstags um Viertel vor zehn wieder im Kino ein. Das Publikum hatte sich ziemlich genau auf die knapp 50 Leute, die auf den weißen Ikea-Sofas Platz haben, reduziert. Auch eine Berliner Eigenart, dass man um zwei Uhr mit mehr Besucher:innen rechnen kann als um zehn.
Als ich meiner Startzeit immer näher kam, stieg die Spannung in mir. Was würde wohl die erste Szene sein, die ins Gedächtnis zurückkehrt? Dann passierte es: In Schwarz-Weiß hastet ein kleiner Junge unentwegt über einen endlos scheinenden Strand. Für einen Augenblick sind wir wieder gemeinsam mit Jean-Pierre Léaud in der Normandie. Und ich bekomme ein wenig Gänsehaut.
Marclays Ode an den Film innerhalb einer Sitzung komplett zu sehen, grenzt an das menschlich Mögliche. Doch genau das nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck: Es ist einfach schön, along for the ride zu sein. Immer wieder kamen Freund:innen vorbei, um mich zu ermutigen und gemeinsam ein wenig auf die Uhr zu starren. Viele taten es uns gleich. Hier hat man schließlich alle Zeit der Welt.