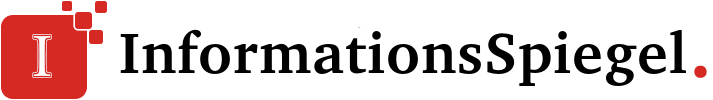taz: Herr Dierssen, als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie setzen Sie sich täglich mit Kindern und auch deren Mediennutzung auseinander. Was beobachten Sie?
Oliver Dierssen: Seit fünfzehn Jahren setze ich mich mit Kindern auseinander. In meiner Praxis habe ich immer Spielsachen liegen. Jeden Tag kommen Eltern mit ihren Kindern, häufig Grundschulkindern und mehr Jungen als Mädchen. Normalerweise sind Kinder expansiv, bewegen sich viel und sind neugierig. Das ist ein normales Erkundungsverhalten. Ich bin gewohnt, dass Kinder beim Betreten des Büros direkt zur Ritterburg gehen und damit spielen. Dann rede ich zuerst mit den Eltern und komme später zu den Kindern an den Spielsachen. Das hat sich aber deutlich geändert, spätestens seit der Lockdownzeit. Seitdem ist das fantasievolle Spiel an der Ritterburg weniger geworden, sodass ich mir aus der Not heraus eine zweite Burg zum Spielen zugelegt habe, diesmal mit mehr Actionfiguren. Doch viele Kinder sind bereits im Wartezimmer am Handy zugange, während Bücher und Spielsachen ausgeblendet werden, die zeigen dort häufig kein Erkundungsverhalten mehr. Später, in den Gesprächen, sind sie überfordert. Manche trauen sich auch nicht an die Ritterburg, und wenn doch, spielen sie nur kurz und sind schnell gelangweilt. Neben der Burg gibt es auch noch Autos, Dinosaurier und weitere Spielsachen. Die Dinos bleiben schon lange im Schrank.
Im Interview: Oliver Dierssen
wurde 1980 in Hannover geboren und ist Kinder- und Jugendpsychiater. Er beschäftigt sich mit Interaktionstörungen in der Eltern-Kind-Beziehung und engagiert sich für gewaltfreie, bindungsorientierte Erziehung.
=”” div=””>
taz: Haben Sie diese Verhaltensveränderungen auch schon vor dem Lockdown bemerkt?
Dierssen: Ich bin seit 2015 in der Praxis tätig und stelle erst seitdem Beobachtungen an. Man muss den Rückgang des Spielverhaltens nicht zwingend auf den Lockdown beziehen, sondern kann sich auch die Frage stellen: Welche Generation ist mit dem Handy aufgewachsen? Das Thema, das in allen Elternberatungen auftaucht, sind elektronische Medien. Darum geht es immer. Bei Mädchen betrifft es mehr Social Media, bei Jungs mehr das Zocken
taz: Welche Mechanismen fesseln die Kinder und Jugendlichen an Handyspiele?
Dierssen: Wir können uns dafür konkret ein Spiel ansehen, das an allen Schulen präsent ist: „Brawl Stars“. Spiele dieser Machart hatten wir bereits in den späten 80er Jahren. Was anders ist: Das Belohnungssystem der Kinder wird durch dieses Spiel massiv und in allen Modalitäten angesprochen. Durch das Blinken, die Geräusche und die konstante Verstärkung ist das Spiel sehr raffiniert programmiert. Man wird ununterbrochen für etwas belohnt. Schon nach dem Starten des Spiels gibt es oft eine Belohnung. Es gibt immer etwas zum Entdecken, wodurch die Kinder nicht mehr zum Durchatmen kommen. Ständig gibt es Effekte, Geräusche und Dinge zum Einsammeln. Das führt in meiner Interpretation zu einer vollkommenen Überstimulierung. Das Gehirn lernt neuroplastisch, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer sein kann und es doch noch belohnt wird. Dadurch werden längere Lernprozesse deutlich schlechter.
taz: Haben die Eltern dann nicht die Verantwortung, den Konsum ihrer Kinder zu kontrollieren und sich mit den Inhalten der Spiele auseinanderzusetzen?
Dierssen: Ja, das sehe ich so. Wichtig ist, zu schauen, welche Informationen den Eltern vorliegen. Früher wurde im Auto mit geschlossenem Fenster geraucht. Das machen heutzutage natürlich weniger Eltern, weil es mehr Informationen darüber gibt, wie schädlich das ist. Ich bin praktisch orientiert. Deswegen halte ich die Eltern dazu an, ein Spiel wie „Brawl Stars“ mindestens eine Stunde selbst zu spielen und darauf zu achten, was das mit ihnen macht. Die Eltern müssen sich nach der Selbsterfahrung die Frage stellen, ob sie ein solches Dauerfeuer für ihr Kind möchten.
taz: Inwiefern sehen Sie dann auch eine Verantwortung bei den Gesetzgeber:innen und den Konzernen hinter den Spielen?
Dierssen: Das ist eine schwierige Frage. Ich sehe, dass viele Firmen die Forschung und wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu nutzen, die Kinder zu den Spielen hinzuführen. Die Erkenntnisse werden also zum Nachteil der Kinder bewusst eingesetzt. Diese Spiele entwickeln sich durch den Markt und die Nachfrage automatisch dorthin, wo der stärkste Belohnungsanreiz ist. Eine Regulation von so etwas ist sehr schwer. Es mag ethische Verpflichtungen zur Selbstregulierung geben, aber ich sehe nicht, dass sich diese Algorithmen ändern. Dass aktuell in Australien beschlossen wurde, Social Media erst ab sechzehn Jahren nutzen zu dürfen, ist natürlich nicht durchsetzbar, aber es zeigt, dass in diesen Medien Gefahren wohnen. Ich finde das einen smarten Schachzug. So könnte man auch manche Spiele altersmäßig begrenzen.
taz: Wie könnte ein verantwortungsvoll designtes Spiel aussehen, das den Kindern nicht schadet und den Firmen dennoch Profit bringt?
Dierssen: Das kann ich nur durch meine kleine Sichtweise betrachten. Ich sehe schon, dass auch Spiele wir „Fortnite“ einen Gewinn bringen können, wie zum Beispiel den sozialen Zusammenhalt unter Freund:innen. Viel stärker ist der Nutzen noch in „Minecraft“, wo man gemeinsam bauen und Projekte umsetzen kann. Die Spiele, die eine unverhältnismäßige Belohnungserwartung schüren, sind das Problem. Die Kinder machen bei dem Spiel kurz mit und erwarten direkt eine Gegenleistung. In der Schule, wenn eine Aufgabe in einem Buch erledigt wird, kommt in der Regel keine Belohnung. Auch beim Spielen mit Playmobil ist der Belohnungsanreiz viel geringer. Aber ein Spiel sollte die Kreativität und die Freiheit in den Vordergrund stellen. „Brawl Stars“ mag alles Mögliche sein, aber sicher nicht fantasievoll. Die Fantasie ist dort sehr zweidimensional, nämlich: Welchen Charakter nehme ich und wo laufe ich entlang? Ein Spiel sollte die Kreativität und die Freiheit in den Vordergrund stellen.
taz: Was braucht es, damit Eltern ihre Kinder besser schulen können im Umgang mit Spielen?
Dierssen: Natürlich setzen Eltern ihre Kinder auch vor die Geräte, weil sie selbst weniger Zeit und eine hohe Belastung haben. Viele Eltern in unserer Praxis sind am Anschlag und haben wenig Erholungszeit. Es ist leicht zu sagen, dass die Eltern dann noch genau nach den Kindern sehen müssen. Dazu brauchen wir auch Lebens- und Arbeitsbedingungen, wo das realistisch ist. Insofern sind nicht nur die Kinder ein Stück weit verloren, sondern auch die Eltern. Es braucht also einen gesellschaftlichen Wandel, in dem Spiel- und Zeiträume entstehen können. Eltern müssen so leben und arbeiten, dass Zeit für die Kinder bleibt.