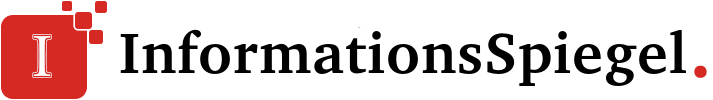Wenn nicht mal der Schlaf kurzzeitig Erlösung bietet, eine Pause von Arbeit und Alltag, dann hat das Elend einen wirklich vollumfänglich verschluckt. „Hoffentlich träumen wir nichts“, ist so ein Satz, der bezeichnend ist für die Figuren, die Urszula Honek mit dunklem Federstrich zeichnet. „Jeder bekommt den Tod, den er verdient“, lässt sie später eine Frau sagen, die es ihrem Retter nie vergeben konnte, dass der sie aus dem Fluss zog, die Taschen voller Steine und bis zum Hals in den Fluten.
Es sind nicht alle so verbittert, in dem kleinen Dorf in den polnischen Beskiden, von dem „Die weißen Nächte“ erzählen. Doch da der Tod in jedem Haus schon einmal Gast war, kommt er selten gänzlich unerwartet – oder unverhofft.
Ein richtiges, gar ein bestes Alter gibt es in Honeks Roman nicht. All ihre Figuren sind entweder zu alt oder zu jung. Die Gegenwart rückt ihnen gleichermaßen zu Leibe. „Man wird alleingelassen, und keiner fragt, ob man morgens aufgestanden ist, oder was für eine Farbe man mag. Das wirst du noch sehen“, warnt eine Großmutter ihre kleine Enkelin.
Es sind jedoch kaum die Erwachsenen, die ihre Kinder erziehen, vielmehr ist es das Dorf selbst – oder die Natur, die Triebe, die in den Pflanzen wie in den Männern wohnen. Eine Mutter, die fürchtet, ihre Tochter könnte ein weiteres uneheliches Kind bekommen, weiß um die Umstände, die auf dem Land zu Schwangerschaften führen. „Er muss dir gar nicht gefallen“, sagt sie. „Es reicht, wenn du ihm nur ein bisschen gefällst.“
Urszula Honek: „Die weißen Nächte. Roman in 13 Geschichten“. Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 160 Seiten, 23 Euro
=”” div=””>
Zeitlose Landschaft
Die Landschaft, die sich im Roman vor der Leserin auftut, ist eigentümlich zeitlos. Nur hie und da blühen Erinnerungen, etwa an die NS-Zeit auf, ansonsten liegt Stillstand wie dichter Nebel über dem Dorf. Das einzige, was sich ändert, ist das Wetter, und das auch immer auf die gleiche Weise.
Es sind meist bereits Bekannte, die Männer und Frauen, die in „Die weißen Nächte“ auftauchen, denn es ist tatsächlich ein Roman in Geschichten, wie auf der ersten Seite angekündigt. Sprechen die Schwestern, Nachbarinnen oder Freunde derer aus den vorherigen Kapiteln, scheinen selten Widersprüche auf. Nie wird überschrieben, lediglich ergänzt. Für große Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung scheint weder Zeit noch Raum vor dieser so kargen Dorfkulisse.
Urszula Honek, die zuvor statt Prosa nur Gedichtbände veröffentlicht hat, beweist große Kunstfertigkeit, von Menschen, die eigentlich kaum über eine Sprache verfügen, derart wortgewandt zu erzählen. Poesie steckt im Knirschen des Schnees wie im Hinken des Schreiadlers, und indem Honek genau zuhört, scheint sich ihre Elegie wie von selbst in Hauptsätzen niederzuschreiben.