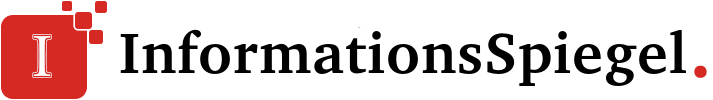F reitagabend in Wedding, am Martha-Ndumbe-Platz. Der Bus zeigt noch den alten Namen an: „Nettelbeckplatz“. Busse sind manchmal langsam im Kopf, denn der Platz wurde bereits im Sommer umbenannt. Etwa hundert Menschen feierten das mit Musik und Vorträgen. Es wurde erklärt, wer Martha Ndumbe war. Sie wurde 1909 in Berlin geboren, afro-deutsch, 1945 wurde sie von den Nazis im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet.
Es wurde auch erklärt, wer Johannes Nettelbeck war. Geboren 1738, gestorben 1824. Im Kaiserreich fand man ihn toll, deswegen benannte man 1884 den Platz nach ihm. Ein Held, Symbolfigur des Widerstands gegen Napoleon. Außerdem war er aktiv am Sklavenhandel beteiligt und verdiente gut daran. Auch in der Nazizeit fand man ihn noch toll. Ein paar Meter entfernt von der Veranstaltung sagte eine Frau, die im Sommer fast immer mit ein oder zwei Bierchen auf einer der Bänke auf dem Platz sitzt, leise zu ihren drei Trinkkumpanen: „Also für mich bleibt ditte hier der Nettelbeckplatz, das kann ich dir aber sagen.“
Nicht weit vom Platz liegt die Bar B-Side. Früher arbeitete dort meist Michael, Amerikaner und Besitzer der Bar. Er wusste viel über Bier, Wein und Punk-Musik. Michael ist seit ein paar Monaten nicht mehr da. Die Bar ist jetzt in neuen Händen, sieht aber immer noch genauso aus wie früher. Sie heißt auch noch so. Das Publikum spricht weiterhin meist Englisch. Am Tresen neben mir wird über Europa geredet, über Merz und Trump, und darüber, dass Berlin schwierig ist für Neuankömmlinge.
Blicke im Nacken beim Betrachten der Stradivari
Am Samstagvormittag im Musikinstrumentenmuseum. „Woher kommen Sie?“, fragt mich eine freundliche Person, die im Museum arbeitet und ein bisschen Small Talk machen will. Ich sage: „Jugoslawien“, obwohl das nicht ganz stimmt. Fortan wirke ich ein wenig verdächtig. Vielleicht liegt es auch an meiner Wollmütze. Ich schaue mir eine Stradivari etwas genauer an. Das bleibt nicht unbemerkt, ich spüre Blicke in meinem Nacken.
Dann plötzlich Glockengeläut. Ho, ho, ho. Let it snow! Die Mighty Wurlitzer erklingt, deshalb bin ich hierhergekommen. Der Architekt Hans Scharoun hat das Museum um diese riesige Kinoorgel herum gebaut – so groß ist sie. Sie ist im Museum über drei Stockwerke verteilt: unten im Keller die Technik, oben im ersten Stock, drei Großkammern, in denen sich riesige Pfeifen, Pauken und Hupen befinden. In der Mitte und zentral im Museum der weiße Spieltisch. Dort sitzt Jörg Joachim Riehle an den Tasten und 205 Registern.
Riehle ist Orgelexperte. Er erzählt, dass die Orgel 1.228 Pfeifen hat und gebaut wurde, um ganze Orchester in Kinos zu ersetzen. 1929 kaufte Werner Ferdinand von Siemens sie in den USA und ließ sie in seine Villa nach Lankwitz liefern – für 85.000 Dollar. Heute wären das laut Online-Inflationsrechner ungefähr 1,6 Millionen Dollar.
Er lässt die Orgel donnern, Vögel zwitschern oder Dracula anklopfen. Es macht großen Spaß
Riehle spielt „Interstellar“ von Hans Zimmer, die Titelmelodie von Harry Potter und schließlich „Last Christmas“ von Wham!. Zwischendurch erzählt er Geschichten über die Erfinder der Mighty Wurlitzer, lässt die Orgel donnern, Vögel zwitschern oder Dracula anklopfen. Es macht großen Spaß.
Am Sonntag trinken wir im Wedding Kaffee. Es ist nicht sehr kalt, warm aber auch nicht. Einer kommt mit Badelatschen und Bademantel herein. Er hat enorm viele Brusthaare, einen Laptop unterm Arm und eine Sonnenbrille auf. Er setzt sich an den Tisch, nippt am Kaffee und beginnt zu tippen. Es sieht nach Arbeit aus.