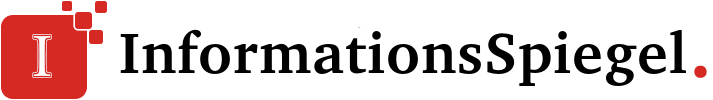B ald ist Weihnachten. Freut ihr euch schon? Ich nicht so (Sorry, Mami, aber du würdest an den Feiertagen vermutlich auch lieber auf dem Hochsitz chillen, als mit uns Wildgulasch zu essen). Dabei verstehen wir uns in der Familie meistens prima – das ist es also nicht. Vielmehr existierte meine Weihnachtsphobie schon, da konnte ich das Wort „Weihnachten“ noch gar nicht richtig aussprechen. Den Familienchroniken zufolge soll sie erstmals auf dem Weihnachtsmarkt zum Vorschein gekommen sein, als ein Typ mit überlanger Gesichtsmähne sich vor mir aufbaute. Ich schrie angeblich wie am Spieß und von dem Tag an brachte bei uns nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind die Geschenke.
Armes Christkind, by the way. Gerade erst auf der Welt, musste es für meine nimmersatten drei Geschwister und mich Baby Born und Plastikgaragen von Mattel durch den Kamin wuchten, obwohl meine Mutter doch viel lieber das gute alte Holzspielzeug unter dem Weihnachtsbaum gesehen hätte. Eines Heiligabends wurde das Christkind dann tragischerweise von einem unserer Hunde angefressen, und so liegt es seitdem kopflos in seiner Krippe.
Viele Jahre unter einem Baum, der nostalgische Christenmenschen in Entzücken versetzt hätte mit seinen echten roten Kerzen und den hübschen Strohsternen, bis er von meinen Eltern irgendwann in einen Coca-Cola-Christmas-Dream transformiert wurde, an dem überdimensionale Schleifen zwischen eisiger LED-Beleuchtung hingen. Man wollte wahrscheinlich mit der Zeit gehen und war es überdies auch leid, jedes Mal Todesängste auszustehen, wenn ungeduldige Kinderhände mit Geschenkpapier um sich warfen, das doch allzu leicht in Flammen aufgeht.
Zum Glück waren meine Geschwister und ich irgendwann so alt, dass wir auch vor unseren Eltern bechern durften, und so verwandelten wir die besinnliche Zeit in ein „Feliz Navidad“-schallendes Besäufnis, das mit einem Crémant aus Kristallgläsern begann und regelmäßig im Rotlichtviertel unserer Stadt endete, wo wir lauwarme Tutschis tranken, mit Polizist*innen rumknutschten und Kuscheltiere aus Kiosken klauten. Wäre ich an der Stelle meiner Eltern gewesen, ich hätte uns zur Adoption freigegeben.
Wir waren uns das größte Fest
Wir aber waren uns das größte Fest, das spätestens mit dem Tod meines Vaters ausgefeiert war. Nun ist das Elternhaus verkauft, meine Geschwister haben Familien gegründet und ich mir eine Monstera zugelegt (Wish me luck!). Darüber hinaus Pandemie, Kriege, Klimawandel, Rechtsruck, Inflation. Da kann man als westdeutscher Provinz-Millennial schon mal sagen, dass manches früher einfach geiler war – manches! Für wenige.
Aber jetzt sind wir in den Sandwichjahren, in denen wir uns selbst um multiple Krisen, die eigenen Eltern, Kinder, Rechnungen und Zimmerpflanzen kümmern und dabei aufpassen müssen, dass es uns nicht so ergeht wie der traurigen Scheibe Tomate. Ein herzhafter Biss vom Leben und schon ist man abgeschmiert. Wobei: Besser runterplumpsen, als vom Stress verdaut werden, sag ich immer, bis ich tödlich beleidigt beim nächsten Weihnachtsessen sitze, weil sich auf dem Land wieder mal niemand für meine Held*innentaten im Großstadtdschungel interessiert. Mit anderen Worten: Auf Familie treffen ist eine Zumutung, aber zumindest in meinem Fall auch ein Quell nicht versiegender Geschichten.
Bin schon gespannt, wer dieses Jahr den Vogel abschießt.