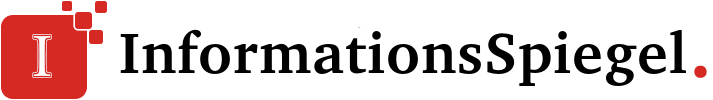Als wir aus dem Urlaub zurückkamen, fanden wir unsere Kreuzberger Eckbäckerei geschlossen. Für immer. Schock. Das betraf nicht nur uns. „Zur süßen Ecke“ – oder das „Café Vielfalt“, wie wir es nannten – war Bäckerei, Café, Kiosk, Späti, Kneipe – und die Anlaufstelle für viele Menschen in unserer Nachbarschaft, die ja eben keine Nachbarschaft im ursprünglichen Sinne eines Dorfes oder einer Kleinstadt ist, wo man sich grüßt, womöglich in der gleichen Firma arbeitet und genau weiß, wer es an Fasching mit wem getrieben hat. Hier leben Menschen in Wohnungen neben- und übereinander, aber das ist es dann oft auch schon.
Das Ungewöhnliche am „Vielfalt“ war, dass da die Leute aus der Plattenbausiedlung Richtung Köpenicker Straße hingingen, die türkischstämmigen Berliner aus der Waldemarstraße. Und wir auch, weil wir keine Lust hatten, ins Arschloch-Café zu gehen. Im Arschloch-Café sitzt ein urbanes, weit gereistes, veganes Currywurst-, Theater- und Museumspublikum. Unsereins. Leute wie wir. Da wollten wir nicht mehr hin. Ist das nicht seltsam?
Wir waren doch aus dem schwäbischen Teil Baden-Württembergs geflohen, um unter Checkern zu sein, die Blöden loszuwerden und dem Muff der alten Heimat zu entkommen, einer Nachbarschaft, die einen grüßt, aber auch observiert und zu Hause fies über einen redet, wenn man die Straße nicht ordentlich gekehrt hat oder was wir da für Vorurteile gegen DIE hatten.
Viele Jahre blieben wir auch in Berlin standhaft anonym. Wir gingen immer in ein Café, das einen Kilometer entfernt war und wo der Latte macchiato (klein) 3,90 Euro kostet. Wie es genau kam, kann ich gar nicht sagen, aber erst kauften wir unsere Brötchen im „Vielfalt“, dann saßen wir samstags nach dem Einkauf in der Markthalle vor dem „Vielfalt“ und tranken einen Kaffee (1.60 Euro), einen Cappuccino (2 Euro), ein Spreequell (1,60) Euro), und aßen ein Franzbrötchen zusammen (1,60 Euro). Dann saßen wir plötzlich jeden Morgen vor der Arbeit Punkt acht Uhr vor dem Vielfalt, bei Wind und Wetter.
Franzbrötchen bereit
Wir standen extra früher auf, um einen Puffer vor der Arbeit zu haben (wenn mir das mal einer früher gesagt hätte!). Dann stellte der Chef schon Kaffee und Cappuccino und Franzbrötchen bereit, wenn er uns kommen sah. Dann rief er schon von Weitem, dass das Spreequell erst wieder am Freitag komme. Dann kannten wir den Namen vom Chef und er unsere, dann erkundigte er sich nach einer Verwandten, weil er mitgekriegt hatte, dass sie im Krankenhaus war. Dann grüßten wir den einen und die andere, die da morgens auch rumsaß. Und irgendwann mehr oder weniger alle (ich übertreibe im Sinne des Literarischen, aber nur leicht).
Der Ort war „konsumistisch“ und Erlös-orientiert, klar, aber eben auch ein Hammer-Soziotop, das für sehr viele Leute tägliche Anlaufstelle war. Wir grüßten die türkischstämmigen Frauen, die einen Frühstammtisch hatten, nachdem sie ihre Kinder weggebracht hatten. Den traurig aussehenden Rentner, der auch im Sommer immer drinnen saß, immer allein, weil (vermuteten wir) niemand anderes mehr in seiner Wohnung saß. Die türkischstämmigen Alten, denen die immer gleiche Frau ihre Formulare ausfüllte, die sie für Behördengänge brauchten oder was weiß ich.
Es gab eine Frühschicht, zu der wir gehörten. Dann kamen gegen halb neun, neun, die Blaukittel und Dienstleister, dem Dialekt nach meist aus der Minderheit der Urberliner. Die aßen in ihrer Pause Mettbrötchen. Irgendwie aßen die alle immer Mettbrötchen, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Früher hätte ich mich darüber echauffiert oder totgelacht (Mettbrötchen!), hier fand ich das irgendwann normal. Machen die halt so. (Ich esse selbst ab und zu Mettbrötchen, aber das darf in unseren Kreisen keiner wissen.) Nach neun weiß ich dann nicht mehr, wer alles kam. Abends kam jedenfalls die Bierschicht, die sahen wir aber nur von Weitem, aber da gehörten wir (noch) nicht dazu.
Wir sagten uns, dass wir bloß aufpassen müssten, weil wir aus dem Grüßen gar nicht mehr rauskämen und ja deshalb nach Berlin gegangen waren, um nicht mehr Hinz und Kunzin grüßen zu müssen. Aber, Sie ahnen es längst, in Wahrheit gefiel uns das, und schlimmer, es tat uns gut, unsere Gegend war weniger grau, auch an Tagen, die sehr grau waren, wir freuten uns schon abends, dass wir morgens wieder hingehen konnten und sagten das auch ständig. „Morgen wieder ‚Vielfalt‘, Hase?“ – „Auf jeden Fall.“ Allein das Reden darüber fühlte sich gut an.
Irgendwann kam unsere Familien-Wokie und ermahnte mich, darüber nachzudenken, ob ich besser nicht von „Café Vielfalt“ sprechen sollte. „Irgendwie süß, aber man könnte es so verstehen, dass du als weißer Mann es schon für Vielfalt hältst, wenn ein paar Türkischstämmige am Nebentisch sitzen.“ Schlimmer: Ich erlebte es schon als Gewinn an Vielfalt, dass an den Nachbartischen immer viel über die Grünen geschimpft wurde, aber niemals, dass sie „nicht links genug“ seien.
=”” span=””>
Wenn die „Wohnzimmer der Gesellschaft“ fehlen, wird die liberale Demokratie Beute der rechtspopulistischen Strategie – das ist die Titelthese, die in der neuen taz FUTURZWEI diskutiert wird. Untertitel: Warum Demokratie Heimat braucht. Mit Luisa Neubauer, Stephan Grünewald, Aladin El-Mafaalani, Maja Göpel, Nora Zabel, Harald Welzer u. v. a., das Magazin erscheint am 9. Dezember, mehr Informationen: tazfuturzwei.de
=”” div=””>
Wie das im gelebten Leben so ist, dachte ich über all das aber nicht groß nach. Erst wenn ich nun am Schreibtisch sitze und darüber reflektiere, komme ich nicht daran vorbei zu sagen: Ich war immer irgendwie zu Besuch in Berlin gewesen, 30 Jahre lang, gefühlt auf der Durchreise, als sei das Leben ein einziges „Davor“, als sei die Gegenwart nicht die einzige Zeit, in der man leben kann, und der Ort, an dem man ist, nicht der nahe liegende Ort, um das zu tun. Das hatte ich bei Harald Welzer gelesen und mich noch gewundert, was den plötzlich so alles umtrieb.
Und nun fühlte ich mich, nicht nur, aber auch wegen des „Café Vielfalt“, langsam aber sicher in meinem Viertel zu Hause und in meinem Leben angekommen. Und wer nun adornitisch rummault, dass das ja wohl alles schwer übertrieben sei, dem kann ich nur sagen: Worum geht es denn im Leben, wenn nicht darum, groß und positiv zu fühlen?
Trauernde Hinterbliebene
Tja, und dann kamen wir aus dem Urlaub zurück und fanden die Läden runtergelassen, die Tür verrammelt, und da hing ein Zettel, der nicht mal vom Chef war, sondern von, man kann das so sagen, trauernden Hinterbliebenen. Es sei „eine große Leere im Alltag der Anwohner*innen entstanden“, hieß es. Und das klingt jetzt seltsam, aber wir waren keine „Anwohner*innen“, das war ja gerade der Witz und das Außergewöhnliche, dass da eben kein Stamm oder Kreisverband unter sich war, keine Peer-Group, sondern Leute. Das Volk in den verschiedensten kulturellen, politischen und sprachlichen Aggregatzuständen.
Ich müsste nun auf die klassisch-politische Ebene wechseln, auf die immense Mietpreiserhöhung zu sprechen kommen und auf den Vermieter, der diese wunderbare Heimat der Verschiedenen zerstört hat. Müsste auf die „Gentrifizierung“ schimpfen (und so tun, als ob ich nichts damit zu tun hätte), müsste den Plattenladen erwähnen nebenan, der auch zugemacht hat (und bei dem ich in 30 Jahren keine einzige Platte gekauft habe). Müsste den Kontext zur Markthalle herstellen, die Worte „Hipster-Metzger“ und „Touristenbespaßung“ verwenden und sagen, dass sich verschiedene Teile der Kreuzberger Gesellschaft davon ausgeschlossen oder abgestoßen fühlen.
Aber die Markthalle ist auch ein Wohnzimmer der Gesellschaft geworden und längst nicht nur Konsumtempel oder wie man das abschätzig nennt. Das ist ein Gewinn. Und unser Café war ein Wohnzimmer der Gesellschaft – und nun ist das weg.
Es gibt ein paar Hundert Meter weiter ein anderes Bäckerei-Café, das uns aufgenommen hat. Auch okay. Wir kommen rein und der Chef ruft jetzt auch schon: „Kaffee, Cappuccino, Franzbrötchen?“ Dann nicken wir und es geht seinen gewohnten Gang.
=”” span=””>
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
=”” div=””>
Das ist schon ein großer Vorteil der Stadt gegenüber dem Dorf, wo es oft nur einen Bäcker und einen Metzger gibt und dann eben gar keinen mehr. Und zunehmend auch sonst keine Orte des Gemeinsamen mehr. Aber trotzdem: Wenn ich jetzt an der „Süßen Ecke“ vorbeigehe, die jahrelang unser „Café Vielfalt“ war, dann ist da mehr als eine Anlaufstelle für Kaffee, Brezeln und Bienenstich verloren gegangen.
Ich traue mich kaum, es mir selbst einzugestehen, aber das war ein Teil meiner Heimat.