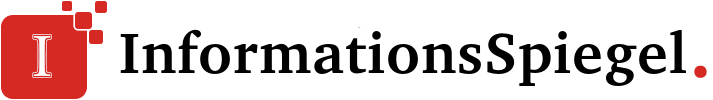D ie Einfahrt nach Kramatorsk verengt sich Anfang Dezember zu einem einzigen Korridor. Über der Straße hängen schwere Netze, die sich im Wind kaum bewegen, als seien sie selbst erschöpft. Unter den Netzen hindurch dauert die Fahrt fast eine Stunde – Schritt für Schritt in Richtung einer Stadt, die sich schon lange wie Front anfühlt.
Vor wenigen Wochen hielten hier noch Züge. Jetzt ist die Strecke still. Die Front schiebt sich jeden Tag ein Stück weiter nach Westen, Städte fallen wie ausgebrannte Haltestellen entlang derselben Linie: Pokrowsk fast besetzt, um Kostjantyniwka Gefechte. Von Kramatorsk bis zur Front sind es fünfzehn Kilometer, eine Distanz, die Drohnen wie beiläufig überfliegen und die für gelenkte Flugbomben kaum mehr als ein Atemzug ist.
Bahnhöfe und Eisenbahnlinien sind kaum noch zu schützen, sie liegen offen im Zielbereich russischer Drohnen und Flugbomben. Deswegen verkehren die Züge jetzt nur noch bis zur Grenze des Gebietes Charkiw und nicht weiter bis Kramatorsk. Und von der Grenze zwischen den Gebieten Charkiw und Donezk an beginnen die langen, mit Netzen überspannten Straßen – die einzigen Verkehrsadern, die die Frontstädte mit dem Hinterland verbinden. Dort entlang verlaufen die Evakuierungsrouten, dort verkehren Linienbusse, Hilfstransporte und der restliche zivile Verkehr.
Die Netze, dieselben Anti-Drohnen-Netze wie auf der Zufahrtsstraße, umhüllen Bushaltestellen und die kleinen Verkaufskioske am Straßenrand, an denen Gemüse und Milch verkauft werden. „In den Netzen verfangen sich Vögel. Neulich haben Soldaten sogar einen Hund daraus befreit. Wir alle sitzen hier wie in einer Falle“, sagt die Rentnerin Vira, die in der Umgebung von Kramatorsk Äpfel und Kartoffeln verkauft.
Serhij Hnezdilov, Soldat
Vira sieht sorgenvoll einem harten Winter entgegen. Der Beschuss ist intensiver geworden, es gibt immer mehr Strom-Notabschaltungen. Auf der Weltbühne werden Verhandlungen geführt, bei denen die Gebiete des Donbass nur Tauschobjekte sind. Aber Vira liest keine Nachrichten aus Washington. Sie hört die Durchsagen endloser Luftalarme in ihrer Stadt, wieder und wieder. „Wieder fliegen Drohnen nach Kramatorsk. Gestern Nacht sind zwei Männer hier in der Nähe ums Leben gekommen, in einem Wohngebiet. Wir müssen uns verstecken“, sagt sie und packt eilig ihre Waren zusammen.
Blütezeit vor dem Untergang
Etwa 30 Prozent des Gebietes Donezk mit einer Bevölkerung von 202.000 Einwohnern sind noch nicht besetzt. Die größte Stadt in der Ostukraine – Kramatorsk, wo noch etwa 80.000 Menschen leben – ist eine Stadt der Kontraste. Einerseits sind hier die Hälfte aller Hochhäuser zerstört. Andererseits blühen gerade die kleinen und mittleren Unternehmen in der Stadt auf. Cafés, kleine Geschäfte und Blumenläden vernageln nach einem Angriff ihre Fenster mit Sperrholzplatten, dann arbeiten sie weiter.
„Vielleicht klingt das seltsam. Aber Kramatorsk erlebt gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung, die Stadt lebt ihr bestes Leben“, sagt Serhij Hnezdilov. Kramatorsk und Slowjansk seien jetzt der größte städtische Ballungsraum des Gebietes Donezk, sowohl für Soldaten als auch für Zivilisten, und diese Stadt sei so etwas wie ein Zentrum geworden – für alle Bewohner des Ostens, für Vertriebene aus Kostjantyniwka, Bachmut, Mariupol und Pokrowsk, die hier Schutz suchten und Arbeit fänden, für alle, die wollten, dass der Osten „unser“ bleibe und die Halden „unsere“ blieben.

Foto: Oleksii Filippov
Diese Menschen eröffneten hier Geschäfte, böten selbst unter Beschuss einen ausgezeichneten Service an und organisierten sogar Kulturabende. Die Stadt liege fünfzehn Kilometer von der Front entfernt, aber gleichzeitig könne man hier ein skandinavisches Frühstück bestellen und einen Café Latte mit laktosefreier Milch trinken, sagt der Soldat der 56. separaten Mariupoler Motoreninfanteriebrigade der ukrainischen Streitkräfte, der seit mehreren Jahren in Kramatorsk stationiert ist und beobachtet, wie sich die Stadt vor seinen Augen verändert.
Serhij, der in Awdijiwka und Bachmut gekämpft hat, hat gesehen, wie eine ostukrainische Stadt nach der anderen zerstört wurde. Und eine gewisse traurige Tendenz bemerkt er auch schon für Kramatorsk. „Bevor sie sterben, erleben die Städte im Osten noch mal eine richtige Blütezeit. Dort konzentriert sich quasi das Leben, es kommen viele Soldaten, viele Freiwillige, neue Unternehmen werden gegründet. Aber dann rückt die Front näher und die Russen beginnen, die Stadt zu zerbomben. Auch Kramatorsk ändert sich, die Stadt wird bereits mit Drohnen beschossen. Aber ich denke, bis zum Frühjahr wird es hier noch o. k. sein. Es dauert noch bis zur Endphase“, sagt Serhij – und betrachtet Kramatorsk als seine zweite Heimatstadt, als Stadt, in die er sich „gezwungenermaßen durch den Krieg verliebt hat“ und für die er sich ein milderes Schicksal erhofft.
Aber nicht alle glauben daran, dass die Stadt diesen Winter unbeschadet überstehen wird. Im Fan-Shop des Donezker Fußballvereins Schachtar ist heute viel los, die Tür geht ständig auf und zu. Militärkleidung hängt neben patriotischen Souvenirs mit Bildern von Kohlehalden und anderen Symbolen des Donbass, als würde hier ein Stück Heimat verkauft. Soldaten schieben sich zwischen den Regalen nach vorne; einer fragt, ob es auf die gekaufte Kleidung eine einjährige Garantie gebe. „Wer kann heutzutage überhaupt noch Garantien für irgendetwas geben?“, erwidert die Verkäuferin Lisa traurig. Sie steht seit der Eröffnung hier hinter der Kasse und sagt es, als hätte sie die Frage schon oft gehört.
„Vor einem halben Jahr haben wir den Laden hier aufgemacht“, sagt Lisa. Jetzt bereiteten sie sich bereits auf den Umzug nach Kyjiw vor: Der Beschuss werde stärker, der Zug aus Kyjiw fahre nicht mehr bis Kramatorsk und alles sei beängstigender geworden. Sie habe schon früher über eine Evakuierung nachgedacht, ihre Familie wolle, dass sie nach Kyjiw komme. Sie sei geblieben, weil der Laden hier sei, aber ihr Freund und sie dächten nun darüber nach, im neuen Jahr wegzugehen. Sie hätten erlebt, wie die Städte um sie herum besetzt worden seien; der Gedanke, dass sich deren Schicksal hier wiederholen könnte, mache ihr Angst. Während sie spricht, legt sie langsam die T-Shirts mit dem Aufdruck „Der Donbass wird frei sein“ zusammen, als müsse sie sich von jedem Stück verabschieden.
Ein paar Straßen vom Laden entfernt räumen Arbeiter die Trümmer eines Wohnhauses weg, das von einer russischen Drohne getroffen wurde. In allen fünf Etagen sind die Fenster kaputt, die Wände voller Granatsplitter. Zwischen Staub und zersplittertem Glas steht eine Tür, vernagelt mit Sperrholz – und dahinter arbeitet trotzdem eine Tierklinik weiter.
Der 70-jährige Rentner Oleksandr, der mit einer grauen britischen Katze zum Tierarzt gekommen ist, betrachtet die jüngsten Zerstörungen in der Umgebung. Der Innenhof seines Hauses sei gestern getroffen worden, erzählt er, auf einer Seite seien alle Fenster kaputt. Auch hier habe es eingeschlagen. Als die Russen sich Kostjantyniwka näherten, sei es ständig laut gewesen – ein Luftalarm nach dem anderen, den man irgendwann kaum noch wahrnehme. Er rechne mit einem harten Winter, weil der Strom so oft ausfalle, und er wisse nicht, wohin man überhaupt gehen solle. „Wir können nur hoffen, dass sie uns bei diesen Verhandlungen nicht an Putin ausliefern“, sagt Oleksandr und beruhigt die Katze, die kläglich in seinen Armen miaut. „Alles wird gut“, sagt er und streichelt das graue Fell des Tieres – doch es klingt nicht so, als glaube er selbst daran.
Oleksandr, Rentner
Anders als in den meisten ukrainischen Städten gibt es in Kramatorsk keine Pläne für Stromabschaltungen. Der Strom fällt trotzdem häufig aus – weil die Energieinfrastruktur immer wieder unter Beschuss gerät, Leitungen reißen und ganze Straßenzüge plötzlich im Dunkeln stehen. Statt kontrollierter Abschaltungen führen hier Einschläge zu Blackouts.
Rote Linien
Der Bahnhof steht jetzt leer. Statt der Schnell- und Nachtzüge fahren hier jetzt die Evakuierungsbusse ab. Täglich bringt allein die gemeinnützige Organisation „Proliska“ etwa 100 Menschen aus Kramatorsk und den umliegenden Dörfern zum nächsten Bahnhof im angrenzenden Gebiet Charkiw. Einige verlassen die Stadt auf eigene Faust und packen ihre Habseligkeiten, Fahrräder und Kinderwagen in private Fahrzeuge. Der Chef von „Proliska“, Jewhen Kaplin, ist jedoch der Meinung, dass die Evakuierungswelle Kramatorsk noch gar nicht erfasst hat.
„Die Leute gehen nach und nach. Zuerst diejenigen, die über die entsprechenden Mittel verfügen. Dann folgen die, die einen Ort haben, an den sie gehen können. Und erst, wenn die roten Linien überschritten werden, verlassen auch alle anderen die Stadt“, sagt Jewhen, der seit Beginn des Krieges im Osten der Ukraine Menschen aus den Brennpunkten rettet.
Kürzlich erst geriet das gepanzerte Rettungsfahrzeug seiner Organisation während der Evakuierung von Menschen aus Druschkiwka, einer Nachbarstadt von Kramatorsk, unter russischen Beschuss. Als „rote Linien“ bezeichnen die Freiwilligen den massierten Beschuss und den damit verbundenen Ausfall der kommunalen Versorgung – den Moment, in dem eine Stadt ohne Strom, Wasser und Heizung bleibt.
„Wenn die Stadt mit Bomben angegriffen wird und es keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung mehr gibt, wird es zu einer Massenflucht kommen“, meint Jewhen. Das habe man schon in Dutzenden anderer Städte im Osten gesehen. Wenn die Temperatur auf minus fünfzehn Grad falle und die Russen Kramatorsk komplett von der Versorgung abschalteten, könnten die Leute nicht bleiben. Sie verstünden, dass Kramatorsk für Putin ein politisches Ziel sei, und wenn Russland beschließe, die Stadt zu erobern, würden sie als Erstes die einheimische Bevölkerung vertreiben. Dass russische FPV-Drohnen in die Stadt eingeflogen seien, zeige ihm, dass diese beunruhigende Entwicklung bereits begonnen habe.
In diesem Herbst versuchten die russischen Streitkräfte zum Beispiel, mit Drohnen die blau-gelbe Fahne zu zerstören, die über Kramatorsk weht. Sie steht auf einem achtzig Meter hohen Fahnenmast im Stadtpark von Kramatorsk – dem größten im gesamten Gebiet Donezk – und wurde noch vor der Invasion errichtet. Von überall in der Stadt kann man diese Fahne sehen.
„Ich denke, wir sollten diese Flagge herunterholen“, unterbricht Soldat Serhij Hnezdilow das Gespräch mit Jewhen. „Es wird sonst sehr schmerzhaft, wenn so ein symbolträchtiger Ort Schaden nimmt.“ Dann steht er auf, er muss zurück zu seiner Kampfposition. Aber er hofft, dass er wieder Kaffee in seinem Lieblingscafé trinken und von dort die blau-gelbe Flagge über einem ukrainischen Kramatorsk sehen kann.
Aus dem Ukrainischen: Gaby Coldewey