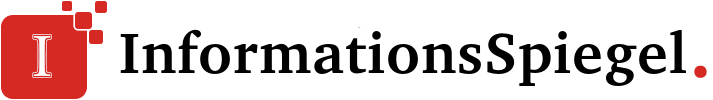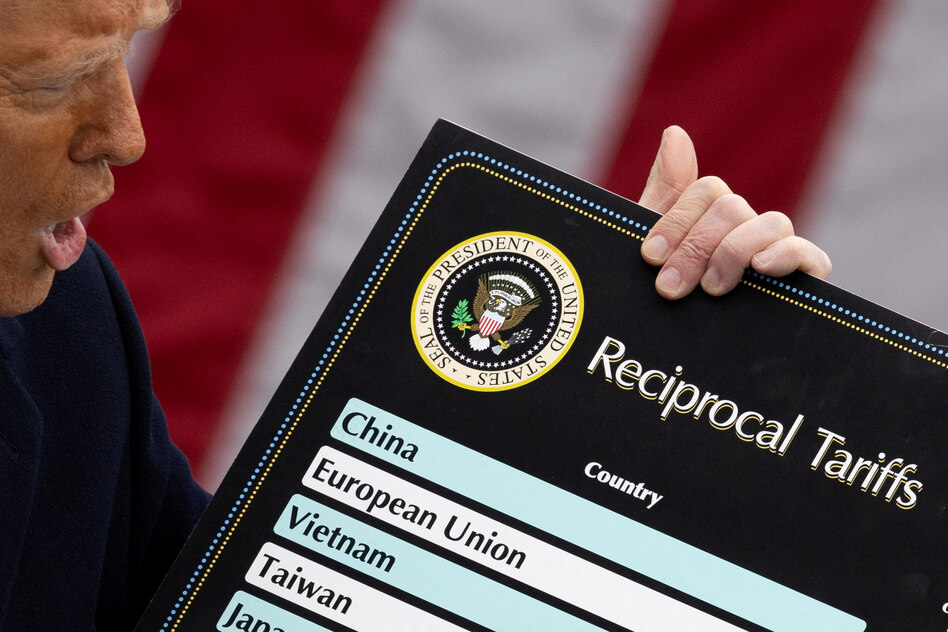Eigentlich ist alles genau gleich. Das Setting (Frauen und Männer daten sich in sogenannten Pods, in denen sie sich nicht sehen, sondern nur hören können), das Konzept („Blind“ Dates, gefolgt von Verlobung, erstem gemeinsamen Urlaub, Zusammenziehen, Hochzeit – und das innerhalb von vier Wochen) und die Dramen (einer kann sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden, bei der anderen sind die Eltern entsetzt über eine so schnelle Hochzeit, durch das Daten der gleichen Männer werden frische Freund*innenschaften auf die Probe gestellt).
Der deutsche Ableger von „Love ist Blind“ funktioniert genau wie die US-amerikanische Version. Doch obwohl das Original für mich die wahrscheinlich beste Dating-Show ist, überzeugt die deutsche Kopie gar nicht. Woran liegt das?
Grundsätzlich schafft gutes Reality-TV die perfekte Balance zwischen Identifikation und Fremdscham. Ich fühle mit den Kandidat*innen, wenn sie beim Dating betrogen werden oder weine vor Rührung, wenn sie sich am Ende doch das Ja-Wort geben. Doch wenn sie etwas wirklich Peinliches sagen oder tun, kann ich mir einreden, dass das alles nichts mit mir zu tun hat.
Alles, was die Kandidat*innen von sich geben, ist peinlich. Alles, was sie tun, nicht nachvollziehbar
Deutschen Reality-TV-Shows gelingt diese Balance nicht. Sie verharren im Fremdscham-Modus. Egal ob „Der Bachelor“, „Love Island“ oder „Too Hot to Handle“: Alles, was die Kandidat*innen von sich geben, ist peinlich. Alles, was sie tun, nicht nachvollziehbar. Eine der wenigen Ausnahmen ist für mich die lesbische Datingshow „Princess Charming“, die es schafft, mich emotional zu berühren. Doch wieso gelingt das deutschen Dating-Formaten so selten? Oder ist gar nicht das deutsche Fernsehen das Problem, sondern vielmehr ich?

Der größte Unterschied zwischen der US-amerikanischen und der deutschen Netflixshow sind die Kandidat*innen. In den USA kommen die Männer und Frauen aus verschiedenen Milieus, sind mal reicher oder ärmer, mal religiös, mal linksliberal, mal konservativ – doch sie eint, dass sie bereit sind, alles zu geben. Nach drei Dates „Ich liebe dich“ sagen? Kein Problem. Nach nur zwei Wochen die Eltern kennenlernen? Aber klar doch.
Die Kandidat*innen und ich
In Deutschland ist die Gruppe viel homogener, doch niemand will „all in“ gehen. Obwohl sich fünf Paare verloben, gesteht sich hier niemand die Liebe. Und ob sie den oder die Verlobte wirklich den Eltern vorstellen wollen, steht auch nicht für alle fest. Das klingt zwar alles sehr vernünftig und nachvollziehbar, doch so funktioniert kein gutes Fernsehen. Dafür braucht es Menschen, die den Mut zu übertriebener Romantik haben.
Doch das Scheitern des deutschen Fernsehens liegt nicht nur an den Kandidat*innen, sondern auch an mir. Mir fehlt die Distanz. Ich fühle mich den Teilnehmer*innen näher – immerhin leben wir im gleichen Land, ich erkenne ihre Dialekte und kenne ihr Wohnorte, vielleicht sind wir uns sogar schon einmal über den Weg gelaufen – und fühle umso stärker den Drang, mich von ihnen zu distanzieren.
Wie, wenn die eigentlich sehr lustige Kandidatin Hanni ihren Verlobten Daniel im ersten gemeinsamen Urlaub auf Kreta ganz ernsthaft fragt: „Darf ich alles anziehen, was ich will?“ Es ist nicht so, als würden in den USA nicht auch ständig patriarchale Muster in den Beziehungen zutage kommen, doch hier sitze ich vor meinem Fernseher und schreie ihm entgegen: „Geht’s noch? Du kannst doch nicht deinen Mann fragen, wie du dich kleiden darfst!“ Ich schäme mich für ihre Frage.
Die Staffel fertig gucken werde ich trotz aller Fremdscham und fehlender Distanz. Denn auch eine schlechte Kopie von „Love is Blind“ ist noch immer unterhaltsamer als vieles, was das deutsche Reality-TV ansonsten zu bieten hat. Und letztlich will ich natürlich wissen, ob Hanni mit Daniel vor den Altar tritt oder sich am Ende doch noch für Ilias entscheidet.