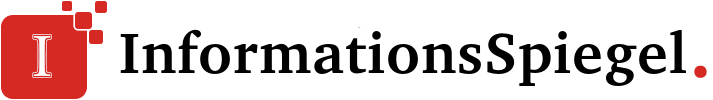Es gibt nicht viele Orte, an denen Menschen verschiedener Herkünfte und Sozialisationen eine geraume Lebenszeitspanne teilen. Und Schulen sind die wichtigsten unter diesen wenigen, weil sie Kinder für ihre noch lange Zukunft prägen. Für Filmemacher*innen ist der schulische Mikrokosmos auch deshalb interessant, weil hier alte Hierarchien auf neue pädagogische Konzepte treffen und Vorurteile wirkmächtige Kreise ziehen. Demografischer und demokratischer Wandel in a nutshell: Das birgt ein ungemein großes dramatisches Potenzial.
Mit Das Lehrerzimmer ist dem Regisseur İlker Çatak vor gut zwei Jahren ein Glanz- und Paradestück des Schulfilm-Genres gelungen. Der gesellschaftspolitisch brisante Psychothriller räumte beim Deutschen Filmpreis in fünf Kategorien ab und war 2024 für den Auslands-Oscar nominiert.
Auch deshalb zu Recht, weil die rasant geschnittene Story auch rasend gut besetzt war: Mit vielen Schauspieler*innen aus dem deutschsprachigen Theater – und mit Leonie Benesch als Protagonistin Carla Nowak, die als die idealistische Neue im Kollegium eines Gymnasiums gegen inquisitorische Praktiken im Haus opponiert und dann selbst zu unlauteren Mitteln greift, um eine Diebstahlserie aufzuklären. Der Film folgt Carlas Perspektive in ihrem Kampf darum, dennoch fair und integer zu bleiben. Die Kamera liebt Beneschs Gesicht und dessen so ausdrucksstarke wie minimalistische Mimik: großartig!
Extrem nah am Film
Wer diesen Stoff auf das Theater übertragen will, braucht Mut und eine richtig gute eigene Idee. Den Mut hatte das Nationaltheater Mannheim, das „Das Lehrerzimmer“ dem jungen, aufstrebenden Regisseur Adrian Figueroa anvertraute und dafür die große Bühne im Alten Kino Franklin freiräumte. Die guten Ideen hatte es leider nicht. Figueroas Version bleibt extrem nah am Film.
Der Text folgt zum großen Teil wortwörtlich dem Original, teils auch da, wo die Inszenierung längst in eine andere Richtung abgebogen ist. Zum Beispiel spricht Carla, hier gespielt von Rahel Weiss, mit einem Schüler, den sie beim Spicken ertappt hat, anschließend über seinen Widerstand bei der Wegnahme der Mathearbeit. Aber die Szene, in der er sich wehrt, wurde gar nicht gespielt.
Derartige unlogische Abweichungen fallen umso mehr auf, weil Figueroa die Filmszenen sonst fast eins zu eins in die unterschiedlichen Räume implantiert, die zwischen den teiltransparenten Stellwänden auf Irina Schicketanz’ Drehbühne entstehen. Der dadurch mögliche Direktvergleich der Schauspielleistungen fällt ebenfalls nicht zugunsten des Mannheimer Ensembles aus.
Eindimensionale Kostüme und Spielweisen beamen das Lehrer-Kollegium um Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück. Aus nachvollziehbaren Charakteren mit Schwächen werden verbohrte Pauker, bei denen es kaum irritiert, dass sie den türkischstämmigen Schüler Ali als Erstes des Diebstahls verdächtigen.
Kraftvoll, dynamisch und genau choreografiert
Fatalerweise zieht sich auch die Hauptdarstellerin auf das vertraute Lehrerinnenklischee zurück, das Kinder mit geheuchelter Anteilnahme und falschem Lächeln abspeist, statt sie (und sich selbst) wirklich ernst zu nehmen. Nur die Mannheimer Kids, die die Schüler spielen, wirken voll und ganz von heute. Ihr Tanz, den die Regie in einige der zwischen den Szenen entstehenden Lücken presst, ist kraftvoll, dynamisch und genau choreografiert.
Andere Versuche, mit surrealen Zwischenspielen eigene ästhetische Akzente zu setzen, wirken dagegen eher hilflos. Kinder, die wie Hausgeister durch die Fenster ins Klassenzimmer starren, und Lehrer, die in Slow Motion durch dunkle Räume robben oder in einer Nische kauernd ihre Armbanduhr anstarren, sollen vermutlich die Kratzer und Sprünge in der Realitätswahrnehmung der Protagonistin beglaubigen und damit bebildern, was nicht erspielt werden konnte. So klar verfehlt Theater das Klassenziel selten.