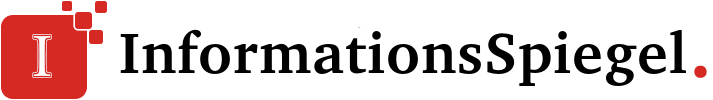taz: Herr Kühnert, wie geht es Ihnen?
Kevin Kühnert: Richtig gut. Ich habe eine spannende neue Aufgabe und auch ein bisschen mehr Zeit fürs Leben.
Im Interview: Kevin Kühnert
Jahrgang 1989, war Juso-Vorsitzender und von 2021 bis 2024 Generalsekretär der SPD. Nach einer Auszeit arbeitet er seit Dezember 2025 als Bereichsleiter für Steuern, Verteilung und Lobbyismus bei der Bürgerbewegung Finanzwende.
=”” div=””>
taz: Sie sind mit 15 in die SPD eingetreten. Waren Juso-Vorsitzender und Generalsekretär und haben im Oktober 2024 mit 35 Jahren Ihre politische Karriere abrupt beendet. Sind Sie froh, den Absprung geschafft zu haben?
Kühnert: Nein, weil die Umstände keine schönen gewesen sind. Das waren 20 sehr wertvolle Jahre, und ich will das alles überhaupt nicht missen. Aber ich bin am Ende nicht heil aus der Sache rausgekommen. Und habe einen Preis gezahlt, der mich dazu gezwungen hat, es sein zu lassen.
taz: Was hat letztlich dazu geführt, dass Sie die Politik aufgeben haben? War es die Ampel, die Krise der SPD?
Kühnert: Krisen gehören in der Politik dazu. Es sind also neben der Gesundheit eher grundsätzliche Erwägungen gewesen. Vor allem die Frage nach meiner Wirksamkeit in Parteipolitik und Parlament. Also inwieweit ich als Person in der Lage bin, dort Spuren zu hinterlassen, die diesen enormen Einsatz auch rechtfertigen. Ich habe mich befragt: Bin ich dafür der Richtige? Die Antwort kennen Sie.
taz: Und jetzt sind Sie in der APO.
Kühnert: Das ist so. Wir sitzen mit Finanzwende nicht in einem Parlament.
taz: Wie fühlt es sich an, sind Sie freier?
Kühnert: Selten habe ich mich Christian Lindner so nah gefühlt.
taz: Sie haben also noch Kontakt?
Kühnert: Wir hatten eigentlich nie Kontakt. Aber im Ernst, den Großteil meines politischen Wirkens bin ich nicht Berufspolitiker gewesen, sondern war ehrenamtlich in einem Jugendverband, in Bündnissen und Netzwerken. Insofern ist vieles, was mir hier wieder begegnet, sehr vertraut: die zivilgesellschaftliche Sicht und der Ansatz, über Öffentlichkeit, über Kampagnen andere zu politisieren und zum Handeln zu bringen. Wahrscheinlich liegt mir das auch besser.
=”” span=””>
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
=”” div=””>
taz: Finanzwende macht zurzeit eine Kampagne für eine Reform der Erbschaftssteuer und fordert die Bundesregierung auf, die Privilegien für Milliardäre abzuschaffen. Sie sind also wieder Antreiber Ihrer eigenen Partei – back to the roots?
Kühnert: Auf eine Art ja, wobei es jetzt gar nicht nur darum geht, die SPD anzutreiben. Wir sind auch keine rot-grüne Vorfeldorganisation. Finanzwende ist eine überparteiliche Organisation, unsere Botschaft geht an die gesamte Bundesregierung, an alle demokratischen Kräfte und vorneweg: an die Gesellschaft.
taz: Sie sind jetzt Lobbyist.
Kühnert: Mein Name steht im Lobbyregister des Deutschen Bundestages, korrekt. Aber ich finde Lobbyismus an sich nicht verwerflich – auch nicht den der Gegenseite. Finanzwende wurde gegründet, weil wir eine extreme Unwucht beim Lobbyismus haben, nämlich eine Überpräsenz derjenigen, die das große Geld und die Kapitalmärkte vertreten bei gleichzeitig weitgehender Abwesenheit der Zivilgesellschaft in diesem Bereich. Und ungleiche Interessenvertretung führt zu ungleichen Politikergebnissen und das festigt ungleiche Machtverhältnisse in der Gesellschaft.
taz: Geht es nicht auch um Umverteilung?
Kühnert: Verteilung spielt auch eine Rolle, aber Finanzwende ist nicht Robin Hood. Uns geht es zunächst darum, die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass Vermögenskonzentration ab einem gewissen Punkt zu unguten Entwicklungen für alle führt.
taz: Wann ist dieser Punkt erreicht?
Kühnert: Er ist längst erreicht. Es gibt ein massives Machtungleichgewicht in der Gesellschaft. Und keine ernsthafte Möglichkeit für die untere Hälfte der Gesellschaft, sich durch eigene Anstrengung aus ihrer Situation zu befreien. Die Grundlage von Chancen und Wohlstand ist heute nicht das Erwerbseinkommen, sondern das Vermögen. Und das wird in Deutschland vererbt. Chancen werden vererbt.
taz: Die SPD hat kürzlich ein Konzept für eine gerechtere Besteuerung von großen Erbschaften veröffentlicht. Aber es kommt ohne konkrete Steuersätze daher. Wie glaubwürdig ist das?
Kühnert: Man kann die SPD dafür kritisieren und sagen, sie verschweigt einen wichtigen Teil. Als jemand, der das politische Geschäft kennt, glaube ich aber, dass es strategisch überlegt gewesen ist. Denn die SPD weiß, dass sie einen Koalitionspartner hat, der nicht von Haus aus etwas an der Erbschaftssteuer ändern will. Ich interpretiere dieses Konzept ohne konkrete Steuersätze als Verhandlungsangebot an die Union.
taz: SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat das Konzept einen wichtigen Impuls genannt. Sehr distanziert. Haben Sie das Gefühl, dass in der SPD alle dahinterstehen?
Kühnert: In der Breite der Partei habe ich schon den Eindruck, dass das so ist.
taz: Und an der Spitze?
Kühnert: Die gehört ja auch zur Breite
taz: Na ja.
Kühnert: Es wird eine Neuregelung der Erbschaftssteuer in dieser Wahlperiode geben. Alle gehen davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht wieder die bisherige Gesetzeslage mit Blick auf die Betriebsvermögen rügen und den Gesetzgeber zu einer Veränderung auffordern wird. Und deswegen ist es folgerichtig, dass die SPD die Debatte begonnen hat. Aber messen lassen muss sie sich am Ende daran, was sie über die Ziellinie bekommt. Ohne die Autorität von Parteivorsitzenden kommt man da nicht weit.
taz: Die Union hat das Erbschaftssteuerkonzept der SPD prompt abgelehnt. Glauben Sie, dass dieser Koalition noch eine gerechte Reform der Erbschaftssteuer gelingt?
Kühnert: Ja, das glaube ich. Denn ich spreche und verstehe Politik immer noch fließend. Ich habe auf der Unionsseite viele Schaufenstersätze gehört, die man halt so sagt, wie etwa: Wir werden keiner Erhöhung einer Steuer zustimmen.
taz: Und wie übersetzen Sie das?
Kühnert: Niemand hat die Erhöhung einer Steuer vorgeschlagen. Wir von Finanzwende, die SPD und in Umfragen auch die Bevölkerung wollen zuvorderst die Begünstigung besonders großer Betriebsvermögen abschaffen. Wenn die weg wären, stünden zusätzliche Milliardeneinnahmen zur Verfügung, mit denen die Politik an anderer Stelle natürlich auch entlasten kann. In diesem Punkt kann man also aufeinander zugehen.
taz: Das Bundesverfassungsgericht hat dreimal die Ausnahmen beanstandet. Die damalige Große Koalition hat die Erbschaftssteuer 2016 reformiert. Seitdem sind die Ausnahmen noch ungerechter. Was macht Sie denn optimistisch, dass es diesmal anders kommt?
Kühnert: Das gesellschaftliche Umfeld, in dem die Debatte stattfindet, hat sich verändert. 2016 hat es Finanzwende noch nicht gegeben und somit keine Gegenöffentlichkeit, die die gesellschaftlichen Interessen herausarbeitet. Wir sind gut vorbereitet auf das, was in diesem Jahr kommt. Und wir merken, dass das auch in Teilen der Union einen Widerhall findet – wenigstens hinter vorgehaltener Hand.
taz: Aber mächtige Lobbyverbände sind nach wie vor gegen eine Reform. Etwa die Familienunternehmen. Kämpft David gegen Goliath?
Kühnert: Finanziell ist das David gegen Goliath. Aber David hat Goliath ja auch mit einer Steinschleuder besiegt. Unsere Steinschleuder sind unsere Argumente.
taz: Welche denn?
Kühnert: Familienunternehmen ist ein rührend gewählter Begriff, hinter dem sich die reichsten deutschen Konzerne verbergen, die mit Sentiment versuchen, dass sich ganz normale Leute für die Interessen von Milliardärsfamilien einsetzen. Und hier setzen wir an: Diese Verbände sprechen nicht für Handwerksbetriebe, sondern für Leute, die wirklich keine finanziellen Probleme haben. Wir denken da etwa an Frau Klatten und Herrn Quandt, denen die Hälfte von BMW gehört. Sie bekommen in manchen Jahren Milliardenbeträge nur an Dividendenausschüttung. Auf dieser Grundlage zu behaupten, eine gerechtere Behandlung bei der Erbschaftssteuer würde die Geschäftstätigkeit gefährden, ist offensichtlich hanebüchener Unsinn.
taz: Aber auch der Parlamentskreis Mittelstand springt ihnen bei. Das ist die große Mehrheit der Unionsabgeordneten, die sagen, der Wirtschaft in Deutschland geht es schlecht. Steigt die Steuerlast der Unternehmen, wäre das Gift für die Konjunktur. Haben sie nicht einen Punkt?
Kühnert: Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht gut, stimmt. Aber die politische Botschaft der Union lautet: Die Unternehmen müssen rundheraus entlastet werden, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch müssen mehr arbeiten, weniger Rentenansprüche erwerben, mehr Beiträge für die Sozialversicherungssysteme zahlen. Die Summe dieser Äußerungen ist eigentlich eine Schuldzuweisung.
taz: So ist es. Arbeit sei zu teuer.
Kühnert: Wir sagen: Arbeit ist in Deutschland so teuer, weil Milliardär zu sein so billig ist. Wenn die Reichsten nicht am günstigsten bei der Besteuerung davonkommen würden, und zwar über alle Steuerarten hinweg, dann hätte der Staat nicht das Problem, an anderer Stelle immer mehr Geld bei Konsumsteuern, bei der Einkommensteuer und per Abgaben reinholen zu müssen, um Renten, Gesundheit und Infrastruktur finanzieren zu können.
taz: Sie haben in einem Podcast gesagt, Sie möchten nie wieder nur eine Sache voll und ganz ausüben. Wollen Sie auch nie wieder ein politisches Amt?
Kühnert: Eine Aussage wie diese treffe ich nicht. Dafür hat man auch mit 36 schon genug Lebenserfahrung, um zu wissen: Manchmal kommen die Dinge anders als man denkt.
taz: Was könnte Sie denn überzeugen, in die Politik zurückzukehren?
Kühnert: Ich verspüre gar kein Bedürfnis danach. Ich bin hier bei Finanzwende nicht auf einem Parkplatz, auf dem ich warte, bis die Schranke wieder hoch geht, sondern ich bin sehr bewusst hier und will bleiben.
taz: Und mit welchem Gefühl beobachten Sie Ihre Partei jetzt vom Spielfeldrand?
Kühnert: Von der Tribüne und mit einer professionellen Distanz.
taz: Bleiben Sie SPD-Mitglied?
Kühnert: Ja, klar.
taz: Das sagen Sie so selbstverständlich.
Kühnert: Was spricht dagegen?
taz: Was spricht dafür?
Kühnert: Mein Opa, der erst nach mir SPD-Mitglied wurde, pflegt in solchen Fällen immer zu sagen: Wenn man in einem Verein Mitglied wird, muss man sich die Satzung angucken. Und wenn man damit übereinstimmen kann, sollte man auch Treue an den Tag legen. Denn die besteht gegenüber den Grundwerten der Organisation und nicht gegenüber Fragen wie: Welche Rolle spiele ich gerade? Gefällt mir der aktuelle Vorstand? Gefällt mir der letzte Beschluss? Ich finde, mein Opa hat recht.