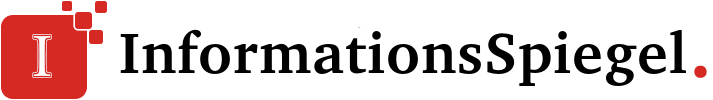Mo, Lene und Mareike sitzen im Wohnzimmer ihrer Wohnung in einer ostdeutschen Großstadt. Draußen scheint die Sonne. In drei Wochen, Mitte Mai, ist der Geburtstermin des Babys in Mos Bauch. Um ihr Familienleben zu starten, haben die drei einen Samenspender gesucht und sind aus unterschiedlichen Städten zusammengezogen. Mo und Mareike haben geheiratet, damit ihr Kind zwei rechtliche Eltern hat. Jetzt ist eigentlich alles bereit für das Baby. Die Initiative für all das ging von Mo aus. Die Namen der drei sind für diesen Text geändert, um ihre Privatsphäre zu wahren. Unsere Autorin ist mit ihnen befreundet, deswegen duzen sie sich.
taz: Mareike, Mo, Lene, wie ist es dazu gekommen, dass ihr zu dritt ein Kind bekommt?
Mo: Ich habe mir ein Kind gewünscht und auch, schwanger zu sein. Mir war aber schnell klar, dass ich das nicht alleine will und auch nicht zu zweit. Mareike und Lene sind die beiden Menschen, mit denen ich mir Elternschaft am besten vorstellen konnte. Also habe ich sie gefragt – mit dem Gefühl, dass ich mich total verletzlich mache. Das ist jetzt dreieinhalb Jahre her.
Im Interview: Mo
ist 34, arbeitet als Sozialarbeiter*in und berät queere Menschen auf dem Land. Mo beschäftigt sich außerdem mit Beziehungsgewalt und möglichen kollektiven Umgängen damit. Mo mag Himbeeren, tanzen, tiefe Gespräche und Pferde.
=”” div=””>
taz: Und dann?
Mo: Haben sie beide gesagt, sie überlegen, was ich schon mal sehr positiv fand. Wir haben uns ein halbes Jahr Zeit zum Entscheiden genommen, die Deadline war unser gemeinsamer Sommerurlaub im August 2022.
taz: Warum ausgerechnet ihr zu dritt?
Mareike: Für mich war sehr wichtig, dass es Leute sind, denen ich extrem nah bin – wie sehr gute Freund*innen. In unserem Fall ist es aber so, dass wir teilweise auch in romantischen Beziehungen miteinander waren.
Im Interview: Mareike
ist 30 und arbeitet in der Forschung. Sie hat ein Faible für popkulturelle Phänomene, liebt es, für andere zu backen, und beschäftigt sich gern mit Hausmeisterinnendiensten.
=”” div=””>
Lene: Und zwar gleichzeitig in einer Poly-Konstellation, also Mareike und ich, wir waren beide über mehrere Jahre gleichzeitig in einer Beziehung mit Mo. Da haben wir geübt, Dinge miteinander auszuhandeln, Urlaub zu dritt gemacht, selbst wenn es gerade schwierig war. Das hat mir viel Vertrauen gegeben.
Mo: Trotz Krisen und Trennungen konnte ich mir noch ein Kind mit euch vorstellen. Das muss man erst mal schaffen!
Lene: Mir war nach deiner Anfrage auf jeden Fall klar, dass, wenn ich ein Kind will, dann mit euch – nicht in einer Zweierkonstellation und nicht in einer romantischen Beziehung.
Im Interview: Lene
ist 34, Juristin und engagiert sich politisch im Bereich Abschiebehaft. Sie fährt viel mit dem Zug zwischen ostdeutschen Großstädten und liest, singt und kocht gern.
=”” div=””>
taz: Warum nicht in einer Zweierkonstellation?
Lene: Ich hatte Angst, dass es mich komplett einnimmt und ich mein ganzes Leben opfern muss. Ich will weiter politisch aktiv sein und weiter Freund*innenschaften pflegen.
taz: Und warum darf keine romantische Beziehung dabei sein?
Lene: Ich verstehe, dass es eine romantische Idee sein kann, gemeinsam ein neues Leben in die Welt zu setzen. Aber romantische Liebe ist doch im Zweifel ein sehr flüchtiges Gefühl. Ich finde es absurd, darauf so viel Verantwortung zu bauen. Viel besser finde ich, ein solches Projekt mit Menschen zu starten, mit denen die Beziehungen beständiger sind. Außerdem stelle ich es mir nicht besonders toll vor, mein romantisches Wochenende immer mit Windeln wechseln und schlaflosen Nächten zu verbringen.
Mo: Ich würde nicht sagen, dass in Elternschaft grundsätzlich keine Romantik dabei sein darf. Und den Begriff Liebe würde ich auch für unsere Beziehungen nutzen. Ich finde, da steckt mehr drin als Zuneigung – auch Verantwortung und Verbündetsein. Für mich war klar: Ohne dieses Gefühl der tiefen Verbundenheit mache ich es nicht. Dann lieber allein. Co-Parenting als Zweckgemeinschaft fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ich hatte eben auch den Wunsch nach Familie.
taz: Was heißt für dich Familie?
Mo: Zunächst eine Gemeinschaft von Erwachsenen, die sich – anders als das Kind – selbst für eine langfristige Verbindung mit mir entscheiden. Man kann auch gut eine Familie sein ohne Kinder. Für mich ist eine solche Gemeinschaft verknüpft mit dem Wunsch zusammenzuwohnen – und das für lange Zeit. Klar, Familie kann auch fürchterlich sein, aber ich möchte mir die positiven Seiten aneignen, also Verbundenheit und Verlässlichkeit. Das bedeutet für mich: Auch wenn es mal schwierig wird, versucht man erst mal, dass es wieder gut wird.
Lene: Mein Verständnis ist eng damit verbunden, wie ich Sicherheit in meinen polyamoren Beziehungen verstehe, nämlich: Wir nehmen uns ernst und schaffen es, Dinge miteinander auszuhandeln. Wenn du dich in jemand anderen verliebst, bin ich nicht weg. Also: Sicherheit durch Nähe und Zuneigung und nicht durch Verbote.
Mareike: Wir alle leben ohnehin in Abhängigkeiten und das stärker anzuerkennen, ist eine feministische Praxis, der ich sehr viel abgewinnen kann. Leute fragen uns immer wieder: Was, wenn ihr euch dann doch anders entscheidet? Das verstehe ich nicht. Wenn man sich die Scheidungsrate anschaut, ist es ohnehin unlogisch, dass gerade wir das so oft gefragt werden.
Lene: Es kann schon sein, dass wir irgendwann nicht mehr zusammen wohnen wollen. Vielleicht braucht eine Person irgendwann mehr Rückzug. Aber das Commitment für die Elternschaft steht damit nicht infrage. Nicht mehr zusammen zu wohnen, bedeutet für uns keine Trennung.
taz: Noch immer gibt es in Deutschland keine gesetzliche Grundlage, um Mehrelternfamilien rechtlich abzusichern. Sich als Paar ausgeben und anschließend die Stiefkindadoption, ist der einzige Weg, damit zumindest zwei von euch rechtlich Eltern werden können.
Lene: Deshalb haben Mareike und Mo geheiratet.
taz: Wie habt ihr entschieden, wer das zweite rechtliche Elternteil neben Mo wird?
Mareike: Das war nicht kompliziert. Ich hatte sehr stark den Wunsch danach, auch nach der rechtlichen Sicherheit, und bei Lene war das nicht so.
taz: Wie fühlt sich das jetzt für dich an, Lene?
Lene: Grundsätzlich noch immer richtig. Nur manchmal habe ich Angst, dass Leute von außen mich nicht als „echte“ Mutter sehen werden. Und natürlich gibt es viele praktische Fragen, zum Beispiel: Welche Vollmachten brauche ich, um mit dem Kind zum Arzt zu gehen?
taz: Zum Verfahren der Stiefkindadoption gehört unter anderem, dass ein*e Fallbearbeiter*in aus dem Jugendamt einen Hausbesuch macht.
Mo: Falls es zu dem blöden Fall kommt, dass das Jugendamt hier nicht nur einen kurzen Pflichtbesuch abstattet, sondern viele intime Einblicke in unser Zuhause haben möchte, werden wir Dinge vorspielen müssen. Verheimlichen wir dann Lene als relevante Elternperson? Das finde ich eine total schlimme Vorstellung.
taz: Spielt der Samenspender eine Rolle in eurem Familienleben?
Lene: Nein. Für unseren Samenspender ist es okay, wenn das Kind ihn kennenlernen will. Aber darüber hinaus soll die Beziehung nicht gehen.
taz: Ihr habt nicht die gleichen Aushandlungsprozesse wie klassische Hetero-Eltern mit einer Mutter und einem Vater, aber trotzdem unterschiedliche Rollen: Eine Person von euch hat geboren, die beiden anderen nicht.
Mareike: Vor der Schwangerschaft war für mich nicht denkbar, dass schwanger sein und gebären am Anfang vielleicht die Beziehung zum Kind beeinflussen wird. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich kann diesen Unterschied mittlerweile anerkennen und finde: Wenn ich eine begleitende Person in der Schwangerschaft sein will und dabei feministisch, muss ich die Arbeit darin sehen.
Lene: Manche Fragen, die unsere unterschiedlichen Rollen betreffen, sind noch offen. Zum Beispiel, wie wir mit dem Stillen umgehen wollen.
taz: Inwiefern?
Lene: Wir haben das Thema Stillen lange vor uns hergeschoben, weil wir wussten, dass es emotional wird. Ganz runtergebrochen: Ich war der Überzeugung, dass eine gleichberechtigte Elternschaft nicht möglich ist, wenn eine Person – was Mo sein würde – voll stillt.
Mo: Für mich war klar, dass ich es gern versuchen will. Einerseits, weil ich einfach gern die Erfahrung machen möchte. Andererseits sind da auch Statistiken und das gesellschaftliche Bild, dass Stillen am besten fürs Baby ist. Davon kann ich mich schwer abgrenzen.
Lene: Ich war dafür, dass wir entweder alle Premilch geben oder eine Kombi aus Stillen und Premilch wählen.
Mareike: Ich hab mir eher eine Position mit Lene geteilt. Auch wegen Berichten von anderen, bei denen durchs Stillen eine sehr einseitige Abhängigkeit entstanden ist. Andererseits: Wer bin ich, der gebärenden Person zu sagen, dass sie nicht stillen soll?
Mo: Dass die beiden die gleiche Meinung hatten, die auch rational sehr überzeugend ist, fand ich total schwierig.
taz: Und worauf habt ihr euch geeinigt?
Lene: Die ersten vier Wochen stillt Mo komplett, dann beginnen wir ein Kombimodell aus Stillen und Premilchflasche.
Mareike: Was genau Kombi heißt, müssen wir dann schauen.
Mo: Wir haben eine sehr hilfreiche Hebamme, die uns in unseren individuellen Wünschen unterstützt. Die grundsätzliche Idee für die Zeit nach den ersten vier Wochen ist, dass jede Person ein Drittel übernimmt. Ich stille in meinem Drittel, die anderen geben Premilch oder abgepumpte Brustmilch. Ob das Kind das mitmacht, wissen wir natürlich nicht.
taz: Wie wollt ihr euch die Zeit mit dem Kind aufteilen?
Mareike: Das Wochenbett möchten wir alle zusammen machen und dann in der Tendenz je ein Drittel der Zeit übernehmen. Aber wir haben zum Beispiel noch nicht besprochen, was es für die Verteilung der Care-Arbeit bedeutet, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten wieder anfangen wollen zu arbeiten. Ich bin angestellt und will nach fünf Monaten wieder anfangen. Als Ehepartnerin kann ich Elternzeit nehmen und bekomme Elterngeld, auch wenn das Adoptionsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
taz: Wie ist das bei dir, Lene? Du kannst ja gar keine Elternzeit nehmen, oder?
Lene: Nein, da unsere Konstellation zu dritt rechtlich weiterhin nicht anerkannt ist, geht das nicht. Ich habe geplant, dass ich eine längere Zeit arbeitslos bin und fange wahrscheinlich nach etwa neun Monaten einen neuen Job an.
taz: Und du, Mo?
Mo: Ich bin selbstständig und fand das eine schwierige Entscheidung, weil der gesetzliche Mutterschutz für mich nicht gilt. Ich habe einen ersten größeren Arbeitstermin etwa zwei Monate nach der Geburt. Danach werde ich wieder arbeiten, aber nicht so viel. Ab Herbst wahrscheinlich wieder mehr.
taz: Teilt ihr euch dann nach Wochentagen auf?
Mo: Darüber haben wir noch nicht geredet. Aber wir wissen, dass wir alle gleich viel Verantwortung in der Beziehung zum Kind übernehmen und gleichberechtigt Eltern sein wollen. Da müssen wir nicht anfangen, die Stunden zu zählen.
taz: Aber über die Nächte habt ihr geredet?
Mo: Ja, die wollen wir immer abwechselnd machen, wenn die ersten Wochen vorbei sind.
taz: Habt ihr schon eine Art Konfliktstrategie, falls es zum Beispiel wieder passiert, dass zwei Personen die gleiche Meinung haben und die dritte nicht?
Mareike: Das ist eher eine Schwachstelle in unserem Plan.
Lene: Klar, das kann emotionale Dynamiken auslösen. Aber ich finde insgesamt schon, dass wir eine Gesprächskultur haben, in der wir Dinge benennen.
taz: Wie haben eure romantischen Beziehungen auf die Schwangerschaft reagiert?
Lene: Es gibt nur eine und das ist meine. Die Reaktion war ambivalent. Einerseits freut sich meine Freundin für mich, aber auch einfach auf das Kind – und andererseits war es komplizierter, als ich vorher dachte.
taz: Warum?
Lene: Wir haben eine Fernbeziehung. Sie hatte Angst, dass weniger Zeit für sie und uns als Paar übrig ist und ich weniger flexibel darin bin, wann wir uns sehen können. Diese Gefühle sind eine Herausforderung – für mich, für sie und für die anderen beiden. Wir drei müssen ja viel gemeinsam aushandeln, beispielsweise wie viel Zeit ich mit dem Kind verbringe und wie viel in meiner Beziehung.
taz: Mo hat gerade gesagt, dass ihr gleichberechtigt Eltern sein wollt. Was heißt das für euch konkret?
Mareike: Ich sehe darin einerseits die Dimension Zeit: Sich die Care-Arbeit und dabei auch alles Nervige gleichmäßig aufzuteilen. Aber genau das wird sich wahrscheinlich stark verändern. Später wird mal die eine, mal die andere die präferierte Bezugsperson sein. Eltern sein heißt dann auch, das auszuhalten.
Mo: Für mich bedeutet es auch: Sich gleich viel Freiheit nehmen dürfen. Aber meine Utopie ist, dass wir uns an unseren jeweiligen Bedürfnissen orientieren. Es geht ja nicht immer allen gleich gut. Nach Bedürfnissen zu handeln, finde ich schöner als die Idee, dass es immer 33 Prozent sein müssen.
Lene: Ein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir alle in der Lage sind, die Grundbedürfnisse des Kindes meistens zu erfüllen – also füttern, schlafen legen, die Nacht allein mit dem Kind verbringen, Trost spenden. Und auch alleine mit dem Kind unterwegs sein.
Mo: Das wird bestimmt auch herausfordernd sein. Aber davon wollen wir uns nicht entmutigen lassen.
Nach der Geburt
Zurück im Wohnzimmer von Mo, Mareike und Lene. Es ist Anfang Dezember, sechseinhalb Monate ist Juli jetzt alt. Hin und wieder kommt ein leises Schnarchen aus dem Babyphone. Am Vortag hatten die drei Mütter den Adoptionstermin beim Gericht.
taz: Herzlichen Glückwunsch zu Julis Geburt! Könnt ihr ihn mir vorstellen?
Mareike: Er wirkt so, als ob er ganz zufrieden auf die Welt gekommen ist und es mag, hier zu sein.
Mo: Er liebt es, wenn gesungen wird und ihm lustige Bewegungen vorgetanzt werden. Am großen Zeh lutschen ist auch sehr beliebt.
Lene: Er ist ausgesprochen strampelwütig und kann sich ganz gut selbst beschäftigen.
taz: Wie sieht gerade euer Alltag aus?
Lene: Wir planen immer ein bis zwei Wochen im Voraus. Ein Tag hat in der Regel vier Schichten: drei Tages- und eine Nachtschicht. Die Nächte rotieren wir, sodass jede Person jede dritte Nacht hat. Die Tagesschichten sind von 8 bis 13 Uhr, 13 bis 18 Uhr und von 18 Uhr bis die Person ins Bett will, die die Nacht hat. Sechs Wochen nach der Geburt haben wir mit dem rotierenden System angefangen.
taz: Bei unserem letzten Gespräch habt ihr gesagt, dass ihr Betreuungsstunden nicht genau abzählen wollt. Jetzt also doch ein straffer Zeitplan?
Mo: Als wir das Schichtsystem eingeführt haben, ging es eher um emotionale als um praktische Gründe. Sehr schnell nach der Geburt hatten sich Rollen und Dynamiken etabliert.
Lene: Mareike hatte das Gefühl, sie muss immer springen. Ich hatte das Gefühl, ich komme gar nicht dazu, meinen eigenen Umgang mit Juli zu entwickeln, weil Mareike ihn dann schon im Arm hat. Es hat gedauert, bis wir darüber nicht nur jeweils mit Mo, sondern auch direkt miteinander gesprochen haben.
Mareike: Für Lene und mich war es das erste Mal, dass wir negative Emotionen zueinander hatten. Wenn es vorher Konflikte gab, dann waren es eher jeweils welche mit Mo. Wir mussten erst mal lernen, Sachen zwischen uns auszuhandeln.
taz: Wie geht es euch jetzt miteinander?
Mareike: Viel besser. Zum Beispiel ist es für uns inzwischen etwas Positives, dass wir beide dieselbe Rolle haben, dahingehend, dass wir nicht geboren haben. Jetzt drücken wir uns Juli auch wieder gegenseitig in die Hand. Vorher haben wir das eher nicht gemacht, weil wir uns gegenseitig verunmöglicht haben, authentisch zu sein.
Lene: „Schicht haben“ heißt auch nicht, dass man alles allein machen muss. Es geht darum, wer hauptverantwortlich ist. Wer auf dem Schirm hat, dass der Rucksack gepackt ist, wenn wir einen Ausflug machen. Oder wer Juli beim Kinderarzt auf dem Arm hält, damit wir das nicht in der Situation klären müssen.
taz: Mareike, seit gestern bist du auch rechtlich Julis Mutter. Im März hast du Mo geheiratet, dann Juli als Stiefkind adoptiert. Wie war ’s?
Mareike: Der Gerichtstermin war sehr kurz, der Richter sehr nett. Ich fand die Situation trotzdem absurd. Juli wurde auch „angehört“, er hat super mitgemacht und genau im richtigen Moment auf den Tisch geklopft. Wir Erwachsenen mussten nochmal bestätigen, dass wir die Adoption wollen. Das war’s.
Mo: Dafür war der Teil mit der Sachbearbeiterin im Jugendamt ziemlich unangenehm. Sie war im November über zwei Stunden bei uns zu Hause und wollte alles von uns wissen: Welche Methode zur Befruchtung wir genutzt haben, ob wir eine glückliche Kindheit hatten, wie es uns in der Grundschule ging …
Mareike: … wie wir entschieden haben, wer Mutter wird.
Mo: Ich war völlig verdattert und hab nicht verstanden, was sie von uns will. Wir sind doch alle Mütter! Wahrscheinlich meinte sie: Wie wir entschieden haben, wer schwanger wird. Gleichzeitig hat sie immer wieder betont, wie sinnlos sie die Stiefkindadoption für lesbische Mütter findet. Wenigstens unsere Wohnung hat sie sich nicht genauer angeschaut. Sie ist einfach davon ausgegangen, dass Mareike und ich zusammen in einem Bett schlafen.
taz: Stillen war eines eurer Konfliktthemen vor der Schwangerschaft. Wie sieht ’s damit inzwischen aus?
Mareike: Ziemlich gut. Wir kombinieren Stillen mit Brustmilch aus der Flasche und Premilch. Zwei Wochen nach der Geburt hat die Hebamme Mo vorgeschlagen, mal abzupumpen. Lene und ich haben angefangen, Juli morgens eine Flasche zu geben. Am Anfang war da nur Brustmilch drin. Und mit fortgeschrittener Zeit dann auch Milch aus unserem Milchvollautomaten.
Lene: Das Ding sieht ein bisschen wie eine Kaffeemaschine aus und funktioniert auch wie ein Kaffeevollautomat: Man bekommt auf Knopfdruck Milch in der richtigen Temperatur. Für mein Gefühl von gleichberechtigter Elternschaft war es elementar, dass Juli nicht minutenlang schreien muss, bis ich die Milch aufgewärmt habe.
Mo: Als wir vier Wochen nach der Geburt angefangen haben, die Nächte aufzuteilen, hab ich ihn noch einmal um Mitternacht gestillt. Nach acht Wochen sind wir in Mareikes und Lenes Nächten komplett auf Premilch umgestiegen.
Mareike: Meine Einstellung vor der Geburt war ja sehr klar: Stillen ist Propaganda und Premilch genauso gut. Als es dann soweit war, fand ich das ambivalenter. Beim ersten Premilchkauf hab ich erst verstanden, dass das ja Kuhmilch ist, Fischöl ist auch drin – das fand ich schon ziemlich räudig, auch wenn es natürlich Sinn macht. Ich habe mich gefragt: Ist das jetzt wirklich okay für Juli? Oder machen wir das nur wegen meines egoistischen Wunsches, ihn allein zu versorgen?
Mo: Ich hatte am Anfang Sorge, dass er dann nur noch die Flasche will, weil das schon einfacher ist, als aus der Brust zu trinken. Und wie die anderen es finden, dass ich ihn stillen will, wenn ich da bin. Es bedeutet ja, dass sie ihn eben nicht ein Drittel der Zeit füttern, was wir mal so vereinbart hatten. Deswegen war es mir wichtig, dass wir uns gemeinsam für dieses neue Modell entscheiden – eben nicht nur, weil ich stillen will, sondern weil es zum Beispiel auch für Julis Immunsystem gut ist.
Lene: Ich bin noch immer überzeugt, dass eine gleichberechtigte Elternschaft unmöglich ist, wenn eine Person voll stillt. Und was ist überhaupt gut fürs Kind? Weniger Allergie, dafür weniger enge Bezugspersonen? Unser Kombimodell finde ich aber super.
taz: Vor der Geburt habt ihr euch vorgenommen, dass ihr alle drei in jedem Moment seine Grundbedürfnisse erfüllen könnt. Klappt das immer?
Mo: Ja, das hat von Anfang an gut funktioniert und mir schon kurz nach der Geburt die Möglichkeit gegeben, mit gutem Gefühl ohne Baby das Haus zu verlassen. Wie genau die ersten Monate ablaufen, hängt aber wahrscheinlich auch viel vom Kind und den Umständen ab.
Mareike: Gleichberechtigt muss nicht bedeuten, dass wir alle zur gleichen Zeit alles genau gleich machen. Weil wir die ersten Wochen so gemeinschaftlich gelebt haben, hat sich das Stillen für mich nicht mehr so bedrohlich angefühlt: Wir haben ohnehin so viel Zeit zusammen verbracht, dass Stillen nur eine Aufgabe von vielen war.
taz: Im April habt ihr gesagt, ihr wollt euch bei der Kinderbetreuung an euren jeweiligen Bedürfnissen orientieren. Wie schaut ihr jetzt darauf?
Mareike: Das haben wir am Anfang ausprobiert. Aber es ist ziemlich schwierig zu definieren, wer jetzt das höchste Bedürfnis hat, Juli auf dem Arm zu halten. Oder aufzuspringen, anstatt erst mal zu Ende zu essen. Vielleicht passt dieser Ansatz nicht so ganz zu einem Leben mit Baby, dessen Bedürfnisse ja eh immer über allen anderen stehen.
Mo: Und trotzdem richten wir unser Leben und unsere Zeiteinteilung sehr bedürfnisorientiert aus. Wenn jemand krank oder müde ist oder einfach nicht mehr kann, dann übernehmen die anderen.
Mareike: Am Anfang war das schwieriger. Dass wir ein anderes Familienmodell als das gesellschaftlich dominante leben, hat bei mir das Gefühl ausgelöst, dass ich mich darin beweisen muss. Leider hieß das für mich auch: durchziehen, komme was wolle.
Mo: Das ging mir ähnlich. Ich hatte das Gefühl, ich muss beweisen, eine „echte“ Mutter zu sein. Da war es für mich gar nicht so einfach, dass dieses Kind mich nicht unbedingt braucht, obwohl ich es geboren habe. Ich hab es die ersten Wochen nicht mal rumgetragen und kaum gewickelt. Klar, das gab mir mehr Freiheit, aber plötzlich hatte ich auch Zweifel: Andere Mütter, die sich hauptsächlich allein um ihre Kinder kümmern, sind von Anfang an sicherer im Alleinsein mit ihren Babys, als ich es war. Plötzlich habe ich eine gesellschaftlich vorgegebene Rolle nicht erfüllt. Das war schwer.
Lene: Da ging es auch um Zugehörigkeit, oder?
Mo: Ja. Beim Rückbildungskurs zum Beispiel habe ich mich das Gegenteil von zugehörig gefühlt: Ich fühle mich nicht als Frau, als die ich aber angesprochen wurde. Ich wurde zu Hause nicht unentbehrlich vermisst, und hatte auch nichts von einem Partner zu berichten, der draußen steht und alles falsch macht. Das scheint irgendwie Teil der kollektiven Erfahrung von Mutterschaft zu sein, und da gehörte ich nicht dazu. Aber anstatt mich zu freuen, dass es bei mir besser läuft, dachte ich: Scheiße, wer bin ich hier eigentlich? Mir haben die Vorbilder gefehlt. Manchmal habe ich mich deshalb nach einer klassischen Rolle gesehnt.
Lene: Manchmal frage ich mich: Wann fliegt auf, dass ich keine „echte“ Mutter bin? Wenn ich im Zug im Kinderabteil sitze, fühle ich mich irgendwie undercover. Alle gehen davon aus, dass ich Teil dieser homogenen Masse bin, die das Baby geboren hat. Und wenn es jetzt Hunger bekommt, dann sehen alle, dass ich nicht stille.
taz: Ist es dir mal passiert, dass Leute komisch reagiert haben, wenn du zum Beispiel im Zug die Flasche gibst?
Lene: Ich hab mich jedenfalls sehr unter Beobachtung gefühlt und war verunsichert: Klappt jetzt alles? Verschütte ich was? Hat die Milch die richtige Temperatur? Die Leute gucken schon. Ich habe auch fast noch nie andere Personen mit Flasche in der Öffentlichkeit gesehen.
Mareike: Ich hab in solchen Situationen immer eher so ein Gefühl von: Game on! Ich find das richtig geschmacklos, wenn Leute uns kommentieren.
taz: Hat sich für euch verändert, was Familie bedeutet?
Mo: Ich glaube, ich habe weniger Exklusivitätsgefühle als in der Schwangerschaft.
taz: Was meinst du damit?
Mo: Mein Nestbedürfnis war in der Zeit sehr groß. Nahe Beziehungen und Freundschaften der anderen haben sich während der Schwangerschaft teilweise bedrohlich angefühlt, obwohl das rational gar nicht meiner Haltung entsprach. Jetzt fühlt sich das zum Glück wieder ganz anders an und sie gehören für mich zur Familie.
taz: Lene, wie ist es jetzt mit deiner romantischen Beziehung?
Lene: Existiert noch (lacht). Obwohl die neue Situation für uns beide ziemlich aufwühlend war. Jetzt läuft’s aber gut, wir sehen uns eher mehr als früher, weil ich in meiner „Elternzeit“ viel flexibler bin, und auch viel häufiger bei ihr in der Stadt. Manchmal nehme ich Juli mit. Ihre jüngere Tochter, sie ist jetzt 13, findet ihn auch ganz süß. Meine Freundin ist sehr liebevoll und kompetent, sie hat ja schon Erfahrung mit Mutterschaft. Es ist schön für mich, die beiden zusammen zu erleben.
taz: Wie geht es euch anderen mit nahen Bezugspersonen?
Mareike: In Freundschaften gab es für mich schon schwierige Momente. Eine sehr nahe Freundin, die für mich auch Familie ist, war enttäuscht von mir, weil ich weniger Zeit und Kopf für sie hatte. Diese Veränderung in nahen Beziehungen kommt vermutlich oft vor, wenn eine Person Mutter wird. Dass das auch in unserer Konstellation passiert, hätte ich irgendwie trotzdem nicht erwartet.
Mo: Ich fühle mich in queeren Kontexten eigentlich immer sehr wohl. Aber plötzlich kam bei mir eine Unsicherheit auf, bestimmte Themen ehrlich zu besprechen. Körperlichkeit wird dort manchmal ausgespart, weil Körper eben gerade nicht über Geschlecht bestimmen sollen. Das entspricht auch meinem eigenen Erleben. Gleichzeitig denke ich: Es wäre gut, Körperlichkeit auch in queeren Kontexten mehr anzuerkennen – Schwangerschaft, Gebären, Stillen, ich spüre meinen Körper darin. Wenn Juli schreit, spüre ich meine Brüste. Wenn ich unterwegs bin, pumpe ich Milch ab. Hormone haben crazy Sachen mit mir gemacht.
taz: Würdest du es trotzdem noch mal tun?
Mo: Ein Kind bekommen? Auf jeden Fall. Ich würde auch gern noch ein Kind mit den beiden bekommen, in dieser oder in einer anderen Rolle. Allerdings würde ich das nächste Mal gerne großzügiger mit mir sein können – zum Beispiel nicht so schnell wieder arbeiten.
Lene: Ich würde nichts anders machen. Wenn noch ein Kind, dann in dieser Konstellation.
Mareike: Ich habe sehr Lust auf ein zweites Kind. Ich liebe unsere kleine Familie.