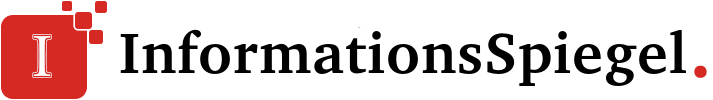Marco Bülow war 19 Jahre lang im Bundestag. Er wurde auf SPD-Ticket direkt in Dortmund gewählt. Der Wahlkreis war eine sichere Bank. Direkt gewählt zu sein bedeutet, dem Wahlkreis mehr verantwortlich zu sein als der Partei – und eben nicht von der Partei auf einen aussichtsreichen Listenplatz bugsiert werden zu müssen.
Bülow war ein SPD-Linker, er engagiert sich gegen Lobbyeinfluss im Bundestag und für die ökosoziale Wende. In der Fraktion galt er nach ein paar Jahren als ewiger linker Rebell. Er war ein eigensinniger, quirliger Geist, der sich an der Großen Koalition rieb. Die Kompromisse, die die SPD, die ewige Regierungspartei, dort als Juniorpartner machte, erschienen ihm allzu schmerzhaft.
2007 schrieb er: „Die Mehrwertsteuererhöhung, die Gesundheitsreform, die Rente mit 67, die vor allem Arbeitnehmer trifft, und zuletzt auch noch die Senkung der Unternehmenssteuer – im Zusammenspiel kann ich darin keine ausgewogene soziale Politik mehr erkennen. Bei einer Fraktionssitzung habe ich auch mal gesagt, dass ich diese Entscheidungen in der Summe nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren könne. Es wurde stiller im Saal, was sonst eigentlich nur passiert, wenn ein Minister oder der Fraktionschef redet. Aber keiner hat etwas erwidert.“
Gut zehn Jahre später trat Bülow aus der SPD aus. Damals galt er auch im linken Flügel als Solitär. Die SPD, so Bülows Kritik, sei in der Großen Koalition „beliebig geworden, ohne erkennbare Haltung“. Anstatt ihre Ideale zu verteidigen, folge die Partei blind der Macht. Seine Austrittserklärung war eine scharfe Abrechnung mit dem sozialdemokratischen Pragmatismus, der schraubstockhaften Logik des kleineren Übels, einer leer drehenden Verantwortungsethik, die vielleicht auch Max Weber kritisiert hätte.
Denn auch bei Weber, dem Kronzeugen der Verantwortungsethik, spielt die Gesinnungsethik eine zentrale Rolle – nur sie verhindert, dass Politik vor lauter Verantwortung zur Verwaltung des Status quo verkommt. Genau das sah Bülow 2018 in der SPD-Fraktion. Sie war eine Maschine geworden, die nur noch ideenarm verwaltete und deren Potenzen, mehr zu wollen, im Maschinenraum der Macht verdorrt waren.
Seit dem Austritt heimatlos
Diese Analyse war nicht falsch. So scharf Bülows Urteil war – die Abnabelung war schmerzhaft. Sie fiel ihm schwer. Auch beim Austritt sprach er noch manchmal unwillkürlich von Wir. Hier der Machtapparat, dort der einsame linke Moralist, der an der Sachzwangslogik verzweifelt – diese Spannung war irgendwann zu viel. Aber sie definierte seine Rolle.
Nur wenige linke SPD-Dissidenten haben nach ihrem Austritt anderswo eine produktive, neue Rolle gefunden. Bülows Suche nach einer neuen Heimat war von wenig Erfolg gekrönt. In die Linkspartei, die nach 2018 in eine tiefe, deprimierende Krise trudelte, wollte er nicht. Er beteiligte sich an Wagenknechts Aufstehen-Projekt, das floppte.
2020 trat er in „Die Partei“ ein und holte 2021 knapp neun Prozent Erststimmen in Dortmund. Das war ein Achtungserfolg. Das Scheitern seiner Post-SPD-Karriere übertünchte es nicht. Politisch wirkte er nach dem SPD-Austritt heimatlos.
Wie am Freitag bekannt wurde, ist Marco Bülow im Januar mit nur 54 Jahren nach langer Krankheit gestorben.